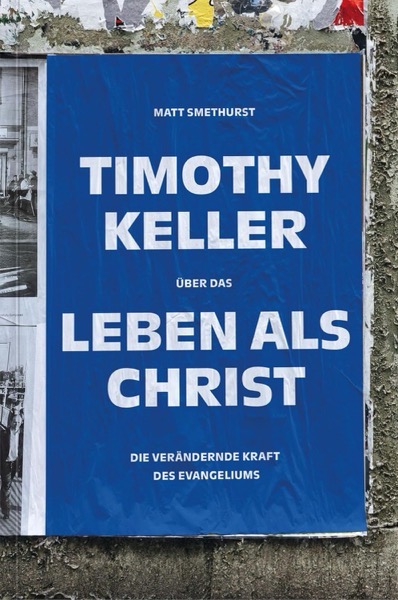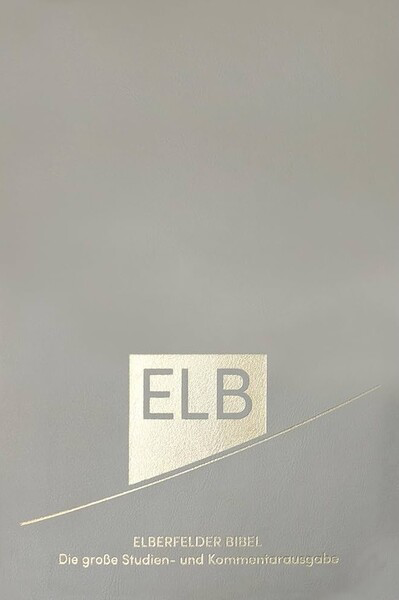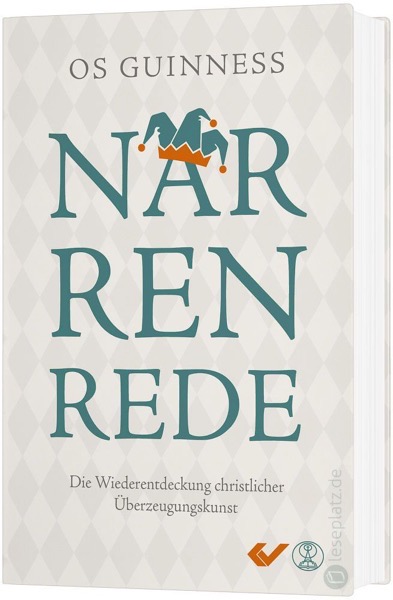Mit freundlicher Genehmigung darf ich nachfolgend einen Beitrag von Thiago Silva wiedergeben, der unter dem Titel „Jüngerschaft und der geistliche Kampf“ zuerst im The Worldview Bulletin Newsletter erschienen ist:
„Es gibt keinen neutralen Boden im Universum: Jeder Quadratzentimeter, jeder Bruchteil einer Sekunde wird von Gott beansprucht und von Satan zurückgefordert.“ – C.S. Lewis, Christian Reflections
1942, inmitten des Donners fallender Bomben und der zerbrochenen Stille des moralischen Zusammenbruchs in ganz Europa, veröffentlichte C. S. Lewis ein seltsames kleines Buch: eine fiktive Sammlung von Briefen eines älteren Dämons an seinen jüngeren Lehrling. The Screwtape Letters (dt. Dienstanweisung für einen Unterteufel) schien zunächst kein natürlicher Erfolg zu sein. Es war nicht inspirierend. Es war nicht im traditionellen Sinne doktrinär. Es bot keinen offensichtlichen spirituellen Trost. Stattdessen bot es einen Blick hinter die feindlichen Linien – einen dunklen Spiegel, in dem der Christ sich selbst sehen konnte. Und in diesem Spiegel offenbarte Lewis, was viele vergessen hatten: dass das christliche Leben ein Krieg ist und das Schlachtfeld die Seele.
Die Brillanz von Lewis’ Vision liegt nicht in großartigen Offenbarungen, sondern in der alltäglichen spirituellen Bildung. Das Ziel des Feindes ist es nicht, den Patienten zu dramatischen Sünden zu verleiten, sondern ihn spirituell im Schlaf zu halten – gelangweilt von der Kirche, stolz auf seine eigene Demut, abgelenkt von der Politik, verliebt in oberflächliche Romanzen, skeptisch gegenüber Leiden und gleichgültig gegenüber dem Gebet. Screwtape will den Glauben nicht mit einem einzigen Schlag zerstören, sondern ihn durch Unordnung ersticken. Jeder Brief ist eine kleine Lektion darüber, wie spirituelle Entwicklung stattfindet – nicht in erster Linie durch spektakuläre Siege oder Niederlagen, sondern durch tausend tägliche Entscheidungen in Bezug auf Gedanken, Gewohnheiten und Herz.
Deshalb sind The Screwtape Letters nach wie vor aktuell. Denn Jüngerschaft – der echte, lebenslange Prozess der Angleichung an Christus – wird im Alltäglichen geformt und geprüft. Und weil der geistliche Kampf nicht nur auf dem Schlachtfeld stattfindet, sondern sich in Küchen, Klassenzimmern, Büros und Kirchenbänken entfaltet. Lewis wusste das. Er schuf ein Buch, das nicht nur clever, sondern auch pastoral war. Hinter der Ironie und Satire verbirgt sich eine leidenschaftliche Liebe zur Seele und eine tiefe Sorge um die Kirche. Das christliche Leben ist, wie Lewis zeigt, keine abstrakte Idee oder ein Wochenendhobby. Es ist eine lange und gefährliche Reise zur Herrlichkeit, die in feindlichem Gebiet unternommen wird, wo wir jeden Tag entweder näher zu Gott kommen oder uns von ihm entfernen.
Verständnis von The Screwtape Letters: Kontext und Inhalt
AlsThe Screwtape Letters 1942 veröffentlicht wurde, befand sich Großbritannien mitten im Zweiten Weltkrieg. Die Nation hatte den Blitzkrieg überstanden, lebte unter der ständigen Bedrohung einer Invasion und hatte mit weit verbreitetem Leid, Angst und Verlust zu kämpfen. Diese Umstände warfen in den Herzen vieler Menschen tiefe moralische und spirituelle Fragen auf. Vor diesem Hintergrund bot C.S. Lewis eine satirische und phantasievolle Reflexion über das Wesen der Versuchung und die subtilen Wirkungsweisen des Bösen im Alltag. Die Briefe, die ursprünglich 1941 als wöchentliche Serie in The Guardian (einer anglikanischen Religionszeitung) veröffentlicht wurden, schilderten das christliche Leben nicht in dramatischen Heldentaten, sondern im Alltäglichen und Gewöhnlichen – genau dort, wo die meisten spirituellen Kämpfe gewonnen oder verloren werden.
Zu dieser Zeit erlangte Lewis durch seine BBC-Radio-Vorträge, die später in Mere Christianity zusammengefasst wurden, ein nationales Publikum. Seine Stimme fand Resonanz in einer Kultur, die zunehmend von Säkularismus, Skeptizismus und dem schwindenden Einfluss des traditionellen Christentums geprägt war. The Screwtape Letters konfrontierte diese Veränderungen mit Witz und theologischer Einsicht und nutzte die fiktive Korrespondenz eines hochrangigen Dämons, um aufzudecken, wie Ablenkung, Stolz und spirituelle Apathie unter dem Deckmantel des normalen Lebens gedeihen. Lewis’ Mischung aus Satire, Theologie und phantasievoller Apologetik bot sowohl Kulturkritik als auch spirituelle Beratung für eine ängstliche und kriegsmüde Generation.
Das Buch besteht aus 31 fiktiven Briefen von Screwtape, einem hochrangigen Dämon, an seinen unerfahrenen Neffen Wormwood, einen jungen Versucher, der einem neu bekehrten Christen zugewiesen wurde, der einfach als „der Patient“ bezeichnet wird. Durch Screwtapes zynische und herablassende Stimme erhalten wir eine zutiefst aufschlussreiche (und oft schmerzlich genaue) Darstellung der Taktiken, mit denen spirituelle Kräfte den christlichen Glauben und die christliche Bildung untergraben. Jeder Brief behandelt ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Versuchung: Stolz, Ablenkung, Beziehungen, spirituelle Trockenheit, Leiden und sogar den Missbrauch von Kirche und Politik. Es gibt keine Kapitel im herkömmlichen Sinne – nur Briefe, die jeweils auf dem vorherigen aufbauen, während Wormwoods Bemühungen, seinen Patienten zu korrumpieren, mit zunehmender Dringlichkeit fortgesetzt werden.
Was das Buch so kraftvoll macht, ist Lewis Verwendung der umgekehrten Theologie. Screwtape bezeichnet Gott als „den Feind“ und beschreibt christliche Tugenden wie Demut, Keuschheit und Liebe mit Abscheu. Diese umgekehrte Perspektive zwingt den Leser, theologisch von der Unterseite her zu denken. Wir werden eingeladen, das christliche Leben nicht durch Idealismus, sondern durch die Linse der spirituellen Opposition zu betrachten. Auf diese Weise beginnen wir, die Subtilität der Versuchung zu erkennen – nicht nur in bösen Taten, sondern auch in verzerrten Wünschen, Gewohnheiten und Lieben.
Screwtape warnt Wormwood davor, sich auf dramatische Sünden zu verlassen. Er ermutigt zu einer kleinen, langsamen Erosion: Er ermutigt den Patienten, Predigten eher zu kritisieren als sie anzuwenden; mit vagen Emotionen zu beten statt mit ehrlicher Beichte; sich auf die Fehler anderer Gemeindemitglieder zu fixieren; Komfort und Sicherheit zu vergöttern; politisches Engagement zu spiritualisieren und dabei das Evangelium zu vergessen. Als solches sind The Screwtape Letters kein Handbuch über dämonische Aktivitäten – es ist ein Spiegel, der die fragile Reise der Jüngerschaft in einer gefallenen Welt widerspiegelt.
Theologisch gesehen ist das Buch von Lewis’ Verständnis der Heiligung durchdrungen. Obwohl er keine systematische Theologie schrieb, ist Lewis’ Vision biblisch: Das christliche Leben ist ein Prozess der Angleichung an Christus durch das Gewöhnliche und das Schwierige, durch Leiden, Gemeinschaft, Buße und Gehorsam. Screwtapes Wut steigt, wenn der Patient spirituell wächst, ohne etwas zu fühlen, wenn er der Versuchung still widersteht oder wenn er selbst in Zweifeln aufrichtig betet. Für Lewis sind dies die Zeichen wahrer Jüngerschaft.
Darüber hinaus endet das Buch nicht mit einer spektakulären Darstellung des spirituellen Sieges, sondern mit dem Tod – dem Moment, den Screwtape als „das Territorium des Feindes” bezeichnet. Und doch findet der Patient gerade hier Frieden. Er wird in die Herrlichkeit aufgenommen, nicht wegen seiner Stärke, sondern weil er bewahrt wurde. Er hat durchgehalten, zögerlich, aber aufrichtig, und die Teufel haben ihren Einfluss verloren.
Das macht The Screwtape Letters zu einem so fesselnden Buch für die moderne Jüngerschaft. Es ist keine Phantasie. Es ist Realismus, verpackt in Fiktion. Es benennt, was wir oft ignorieren: dass jeder Christ in einem Kampf steht, nicht nur gegen äußere Zwänge, sondern auch gegen innere Abwege. Dass unser Verstand und unser Herz ständig geformt werden – und dass bewusste, von Gnade geprägte Jüngerschaft der einzige wahre Widerstand ist.
Ein Porträt des Jüngers im Werden
Der Patient, der anonyme Mann im Mittelpunkt von The Screwtape Letters, ist kein spiritueller Held. Er ist kein Märtyrer, Mystiker oder Visionär. Er ist kein Heiliger, dessen Leben eines Tages in Buntglasfenstern verewigt wird. Er ist, nach allem Anschein, unauffällig. Und genau das macht ihn so mächtig. Denn er ist wir.
Lewis entschied sich, dem Patienten keinen Namen zu geben, um ihn nicht außergewöhnlich erscheinen zu lassen, sondern ihn als einen ganz normalen Menschen darzustellen – als eine Mischung aus unzähligen Gläubigen, die sich im christlichen Leben vorwärts stolpern. Er bekehrt sich früh in der Geschichte, beginnt, die Kirche zu besuchen, betet (wenn auch unregelmäßig) und versucht, ein moralisches Leben zu führen. Aber er ist oft verwirrt. Er kämpft mit Lust, Stolz, Angst, Faulheit und geistiger Trockenheit. Seine Gefühle sind gemischt. Seine Motive sind unklar. Seine Überzeugungen stehen unter Druck. Er wird von Kultur, Freundschaften, intellektuellen Modetrends und persönlichen Schmerzen beeinflusst. Und doch nimmt trotz alledem etwas Reales in ihm Gestalt an. Er wird zum Jünger gemacht – nicht im programmatischen oder institutionellen Sinne, sondern im formativen spirituellen Sinne. Sein Leben wird geprägt – entweder durch die Angleichung an Christus oder durch die Verformung durch die Welt.
Screwtapes Anweisungen liefern einen finsteren Lehrplan der Anti-Jüngerschaft. Sein Ziel ist es nicht, den Patienten mit einem Schlag zu vernichten, sondern ihn daran zu hindern, jemals zu wachsen. Er trainiert Wormwood, Selbstzufriedenheit zu fördern, Emotionen auszunutzen und Passivität zu pflegen. Wie er sagen würde: „Der sicherste Weg zur Hölle ist in der Tat der allmähliche – der sanfte Abhang, weich unter den Füßen, ohne plötzliche Wendungen, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser.“ (Screwtape, Brief 12). Deshalb will Screwtape die Sichtweise des Patienten auf das Gebet verzerren, indem er es selbstbezogen macht. Er korrumpiert die Demut, indem er den Patienten stolz darauf macht, demütig zu sein. Er macht sogar die Kirche zu einer Quelle der Irritation – indem er die Heuchelei anderer verstärkt, soziale Unterschiede überhöht und die spirituelle Vitalität durch Routine abstumpft.
Und doch frustriert Screwtape am meisten, dass der Patient sich zu verändern beginnt – nicht dramatisch, aber aufrichtig. Er beginnt zu gehorchen, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Er bereut, ohne sich zu rechtfertigen. Er wendet sich Gott zu, auch wenn er keinen spirituellen Trost findet. Das sind die Momente, in denen Screwtapes Einfluss nachlässt. Denn durch diese stillen Akte des Gehorsams reift der Patient. Er wird geheiligt – nicht in Herrlichkeit, sondern in Standhaftigkeit.
Seine Beharrlichkeit ist nach weltlichen Maßstäben nicht beeindruckend. Sie ist nicht dramatisch. Sie ist nicht einmal besonders sichtbar. Sie ist zerbrechlich. Aber sie ist echt. Er betet weiter. Er geht weiter in die Kirche. Er beichtet weiter. Er geht weiter seinen Weg. Und am Ende der Briefe, als der Tod eintritt, ist es kein Schrecken, sondern ein Triumph. Er wird in die Gegenwart Christi aufgenommen – nicht weil er Großes geleistet hat, sondern weil die Gnade ihn festgehalten hat. Er tritt nicht als spirituelle Berühmtheit ein, sondern als Jünger. Und das ist genug.
Das macht The Screwtape Letters so kraftvoll, besonders heute. Es stellt das christliche Leben nicht in geschönten, heroischen Tönen dar. Es malt in Grau, in Kampf, in stiller Zuversicht. Es erkennt Zweifel, Versuchung, Erschöpfung und Sünde an – und beharrt dennoch darauf, dass Gott inmitten all dessen am Werk ist. Es erinnert uns daran, dass Jüngerschaft nicht den Starken vorbehalten ist. Sie ist für die Schwachen, die sich an die Gnade klammern. Sie ist für die Ängstlichen, die zu Christus zurückkehren. Sie ist für die Müden, die nicht aufgeben. Mit anderen Worten: Sie ist für uns.
Die Geschichte des Patienten ist keine Geschichte spiritueller Exzellenz. Es ist eine Geschichte der Treue. Und letztendlich sieht Heiligung genau so aus: langsam, kostspielig, gewöhnlich und schön. Die Geschichte des Patienten versichert uns, dass Jüngerschaft möglich ist – nicht nur für die Außergewöhnlichen, sondern für alle, die sagen: „Herr, ich glaube – hilf meinem Unglauben.“
Jüngerschaft und geistlicher Kampf
Wenn Sie sich näher mit diesen Themen befassen möchten, lesen Sie mein Buch Discipleship and Spiritual Warfare: From the Screwtape Letters to the Christian Life. Es handelt sich dabei nicht um einen Kommentar im herkömmlichen Sinne. Das Buch entschlüsselt nicht Lewis’ Briefe einzeln und versucht auch nicht, jede Metapher in eine theologische Form zu pressen. Stattdessen handelt es sich um eine theologische und pastorale Reflexion über die Welt, die Lewis heraufbeschwört – eine Welt des geistlichen Kampfes und der geistlichen Bildung, in der das christliche Leben unter feindlichem Beschuss gelebt wird. Es ist eine Meditation über Jüngerschaft, die im Kontext des Krieges geschmiedet wurde.
Warum diese Kombination – Jüngerschaft und geistlicher Kampf?
Weil das christliche Leben keine neutrale Reise der Selbstverbesserung ist. Es ist ein Krieg der Treue. Christus nachzufolgen bedeutet, sich in einen umkämpften Raum zu begeben. Es bedeutet, von der Gnade beansprucht und vom Feind gejagt zu werden. Es bedeutet, täglich mit Jesus durch Prüfungen, Versuchungen, Leiden und kleine Siege zu gehen – zu lernen, wie man betet, wie man liebt, wie man widersteht, wie man durchhält. Und Lewis lehrt uns durch die umgekehrte Logik seiner Dämonen, wie der Feind arbeitet, damit wir lernen können, wie die Gnade siegt.
Lewis wusste, dass Krieg nicht immer dramatisch ist. Oft ist er langweilig. Die Waffen der Hölle sind nicht immer Gewalt und Chaos, sondern Langeweile, Ablenkung, Groll, Stolz und geistige Apathie. The Screwtape Letters zeigen uns, wie die Hölle Krieg führt, nicht indem sie Gläubige überwältigt, sondern indem sie sie langsam betäubt – indem sie sie mit kleinen Kompromissen nach und nach von der Wahrheit entfernt. Der Patient fällt nicht mit einem Knall, sondern durch Abdrift. Diese Einsicht macht Lewis meiner Meinung nach zu einem großartigen Wegweiser für die Jüngerschaft in der Moderne.
In einer Zeit, in der das Böse trivialisiert, das Übernatürliche abgelehnt und das Christentum auf Therapie reduziert wird, ist Lewis’ Vision eine erfrischende Korrektur. The Screwtape Letters erinnern uns daran, dass das christliche Leben ein umkämpftes Terrain ist. Der Feind zieht Ablenkung dem Unglauben vor, Selbstzufriedenheit der Konfrontation, Zynismus dem Mut. Aber das Evangelium erinnert uns an eine größere Wahrheit: Christus hat gesiegt. Sein Tod hat die Mächte entwaffnet, seine Auferstehung hat ihre Niederlage besiegelt, und sein Geist rüstet seine Kirche zum Durchhalten. Ein Jünger zu sein bedeutet, in dieser Realität wie ein Soldat zu leben: der Versuchung zu widerstehen, die Liebe neu zu ordnen und mit der Kirche bis zum Ende durchzuhalten.
–––
Thiago Silva erhielt seine theologische Ausbildung an der Mackenzie Presbyterian University (Brasilien), dem Calvin Theological Seminary und dem Puritan Reformed Theological Seminary. Dr. Silva ist Pastor der Bethel Presbyterian Church (PCA) in Lake Charles, Louisiana, und Stadtdirektor des C.S. Lewis Institute Lake Charles. Er ist Autor von Discipleship in a Post-Christian Age: With a Little Help from C. S. Lewis und Discipleship and Spiritual Warfare: From the Screwtape Letters to the Christian Life.