Zeit für Gottes Gegenwart
Kürzlich habe ich mal wieder ein älteres Buch aus dem Regal genommen, um ein wenig darin zu stöbern. Die Festschrift zum 70. Geburtstag von Jürgen Moltmann erschien 1996 unter dem Titel Die Theologie auf dem Weg in das dritte Jahrtausend (Gütersloh: Chr. Kaiser).
Das Buch enthält Aufsätze renommierter Theologen, darunter Christian Link, Wolfhard Pannenberg, Nicholas Woltersdorff oder Hans Küng. Die Qualität der Beiträge ist schwankend. Der gelehrte Beitrag von Miroslav Volf spiegelt den Einfluss von George Lindbeck, Michael Foucault und Nancey Murphey auf seine Theologie. Im Zeichen der Heiligen Geistin steht der Aufsatz von Elisabeth Moltmann-Wendel, der Ehefrau von Jürgen Moltmann (die übrigens über den Theologiebegriff von Hermann Friedrich Kohlbrügge promovierte). Der Titel »Wohnt in meinem Fleisch nichts Gutes?« verrät viel. Die Zeit sei gekommen, dass der feministische Spiritualismus die frauen- und körperfeindlichen Bahnen der paulinischen Theologie aufbreche und an der anfänglichen Jesusbewegung anknüpfe. »Wir brauchen eine Frauenkirche« (S. 323).
Bemerkenswert finde ich den Aufsatz »Zeit für Gottes Gegenwart« von Ingolf U. Dalferth (Universität Zürich). Sein Text enthält so viele gute Anstöße, dass ich einige längere Zitate wiedergebe:
Wir leben in einer schnellebigen Zeit. Keine andere Generation hat so viele Aufbrüche in die Zukunft erlebt wie wir, und keine hat ihre Aufbrüche in so schneller Folge wieder korrigieren und revidieren müssen. Trägt morgen noch, was heute gilt, wenn doch schon heute kaum mehr hilft, was gestern galt? Immer schneller entschwindet die Vergangenheit, und unsere Schwierigkeiten wachsen, aus ihr für Gegenwart und Zukunft zu lernen. Wir sind skeptisch geworden und trauen unseren Traditionen nicht mehr. Erweisen sie sich doch zunehmend als untauglich, die Probleme unserer Gegenwart zu begreifen oder gar zu lösen, weil sie in Lebenserfahrungen gründen, die nicht die unserer Zeit und Epoche sind. Uns haben sie daher immer weniger zu sagen. Sie werden uns täglich fremder. (S. 146)
Gott ist gegenwärig und in seiner Liebe hier und jetzt wirksam – aus dieser Einsicht lebt der Glaube, und das und nichts anderes ist das wirklich Wesentliche, das die Kirchen auch heute den Menschen in aller Deutlichkeit zu sagen schuldig sind. Das ist keine harmlose Botschaft, denn diesen Glauben gibt es nicht ohne die permanente Anfechtung, die der oft unerträgliche Widerspruch unserer faktischen Wirklichkeitserfahrung zu diesem Glauben darstellt: Wenn Gott als Liebe gegenwärtig wirksam ist, wie kann unsere Welt und unser Leben dann so sein, wie sie sind? Ohne von Sünde und von einer Schöpfung zu reden, die noch nicht ist, was sie sein soll und sein wird, läßt sich die Glaubenswahrnehmung der gegenwärtigen Wirksamkeit von Gottes Liebe nicht öffentlich verantworten. Wer auf die Rede von Sünde, Schuld und Verhängnis verzichten will, verharmlost den Glauben und spricht ihm gerade das ab, was ihn auszeichnet: daß er aufgrund seiner Wahrnehmung der Gegenwart von Gottes Liebe höchst sensibel macht (oder doch machen sollte) für die vielfältigen offenen und verdeckten Widersprüche gegen Gottes Liebe in unserer Erfahrungswelt. Glaubende leiden an diesen Widersprüchen, suchen sie zu beseitigen und wissen doch, daß sie diese Widersprüche durch ihr eigenes Tun nicht aus der Welt schaffen können, weil sie weder die Folgen ihres Handelns zureichend kontrollieren noch die Voraussetzungen ihres Lebens umfassend in den Griff bekommen können. Glauben gibt es deshalb auch nicht ohne die Hoffnung auf Gottes eigene Vollendung dessen, was als Gegenwart seiner Liebe wahrgenommen wird und doch oft nur kontrafaktisch bekannt werden kann. (S. 151)
Die Bedeutung des Glaubens ist seine Wahrheit, und diese Wahrheit gilt für alle oder für niemand. Wenn Gott so gegenwärtig ist, wie die Christen glauben, dann haben es alle mit Gott zu tun, ob das von allen wahrgenommen wird oder nicht.
Einwände, die auf die Kontextualität des christlichen Glaubens, die angebliche Relativität seiner Wahrheit oder den autoritären Charakter seines Absolutheitsanspruchs verweisen, verwirren wohl zu unterscheidende Sachverhalte. Daß christlicher Glaube nur konkret und damit in kontextueller Bestimmtheit gelebt werden kann, macht seine Gültigkeit nicht abhängig von bestimmten Kontexten: Die Wahrheit christlichen Glaubenslebens hängt an der Wahrheit des Evangeliums, dem sich der Glaube verdankt, nicht umgekehrt. Es macht auch keinen Sinn zu sagen, dieser Glaube sei ›für mich wahr‹, aber nicht notwendig auch für andere. Was immer unter ›Wahrhei‹ verstanden wird: Wer sagt ›Das ist für mich wahr‹, sagt damit ›Ich glaube, daß es wahr ist‹, und beansprucht eben damit, daß es nicht nur für ihn, sondern auch für andere gilt. Die Wahrheit des Glaubens hängt nicht daran, daß sie geglaubt wird, sondern daß die Wirklichkeit so ist, wie geglaubt wird. Wenn aber wahr ist, daß Gott so gegenwärtig ist, wie der Glaube bekennt (nämlich als erbarmende und alles neu machende Liebe), dann gilt das universal, überall und immer und unbeschadet dessen, was wir davon halten oder wie wir uns dazu verhalten.
In diesem Sinn impliziert der Glaube an Gott eine realistische Einstellung zur Wirklichkeit. Damit ist er von grundlegend anderer Art als die postmoderne Attitüde, die vorgibt, zwischen Konstruktion und Wirklichkeit, Gott und unseren imaginativen Gottesbildern und Gottesvorstellungen nicht sinnvoll unterscheiden zu können. Wie immer, wenn eine halbe Wahrheit zur ganzen erklärt wird, wird damit alles falsch. Die richtige Einsicht in das unbegrenzte Diskurspotential der Sprache verführt dazu, sich von einer realistischen Einstellung zu den Wirklichkeiten, in denen wir leben, zu verabschieden. Daß damit eine der zentralen Errungenschaften aufgeklärten Denkens, die kritische Unterscheidung von Wahrheit und Macht, zunehmend unterminiert wird, wird meist nicht gesehen. Doch seit Sokrates gegenüber den Sophisten deutlich machte, daß die Wahrheit zu wissen etwas anderes sei als sich eine Meinung einreden zu lassen, war die Unterscheidung von Wahrheit und Macht für das europäische Denken grundlegend. An ihr hängen nicht nur Wissenschaft, Philosophie und Theologie im uns bekannten Sinn, sondern auch Moral, Politik und das Funktionieren demokratischer Gesellschaften. Auch wenn es in kaum einem Bereich völlig verläßliche Methoden zur Gewinnung von Wahrheitsgewißheit gibt, bedeutet das keineswegs, daß auf die kritische Frage nach der Wahrheit, nach dem, was unter allem Möglichen wirklich ist und in der Vielfalt des Gemeinten mit Recht Geltung beanspruchen kann, verzichtet werden könnte. Wo die damit anvisierten Unterscheidungen nicht mehr gemacht werden, wird verantwortliches Handeln und damit menschliches Leben unmöglich. Wo gehandelt wird, werden solche Unterscheidungen in Anspruch genommen, und in allen lebensrelevanten Bereichen wissen wir sie auch mehr oder weniger gut zu gebrauchen, was immer uns konstruktivistische Theoretiker einreden möchten. Versuchen wir aber nicht selbst nach bewährten Kriterien zwischen wahr und falsch, gültig und ungültig, möglich und wirklich zu unterscheiden, sondern überlassen das andern, wird Wahrheit mit der Meinung derer gleichgesetzt, die die Macht besitzen, oder – wie in unseren Gesellschaften – mit dem, was Mehrheiten glauben oder Medien glauben machen. Und wir sollten uns dann nicht wundern, daß in unseren Gesellschaften nicht mehr die Bemühung um Wahrheit und Wissen, sondern vor allem die Fähigkeit zählt, Sprache und Medien so zu benützen, daß Mehrheiten für die eigene Meinung oder die eigenen Interessen gewonnen werden. Wo die wirklichkeitserschließende Kraft der Sprache bestritten und ihr die Fähigkeit zur Referenz auf sprachunabhängige Wirklichkeit abgesprochen wird, steht zu befürchten, daß Wahrheit von Mehrheiten und Marktgesetzen abhängig gemacht wird. Selbst Religionen werden zunehmend nach diesem Muster betrachtet: als ein Markt der Möglichkeiten für Sinnangebote, aus denen wir nach unseren individuellen Wünschen und Bedürfnissen, aber nicht unter dem Gesichtspunkt von Wahrheit und Unwahrheit auswählen. (S. 154–156)
Die Theologie der vergangenen Jahrzehnte hat nicht unwesentlich zu diesen Entwicklungen beigetragen. Sie hat weithin das methodologische Dogma übernommen, daß nicht Gottes Wirklichkeit und wirksame Gegenwart, sondern allein die religiösen Phänomene menschlicher Existenz und Geschichte auf rational vertretbare und akademisch respektable Weise erforscht werden können, und sie hat – oft ohne dies zu merken – mit den Methoden der entsprechenden Wissenschaften auch deren Vorurteile übernommen. Was sich nicht auf empirischem und historischem Weg thematisieren lasse, sei Sache privater Überzeugungen, individueller Wünsche und Vorstellungen oder vielleicht noch sozialer Bedürfnisse, auf jeden Fall etwas, das allenfalls Gegenstand sozialwissenschaftlicher, nicht aber theologischer Untersuchungen sein könne. Es ist höchste Zeit, daß sich die Theologie von diesem irreführenden methodologischen Dogma verabschiedet. Es gibt nichts, wovon sie reden oder was sie erforschen könnte, wenn es Gott nicht gibt. (S. 156)
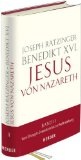 Morgen erscheint der zweite Teil des
Morgen erscheint der zweite Teil des