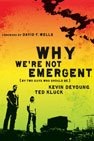Gary L.W. Johnson behauptet in seiner Einführung zu dem kürzlich vorgestellten Buch Reforming or Conforming? (Crossway, 2008, ›Introduction‹, S. 15–26), dass zahlreiche post-evangelikale Theologen den erfahrungstheologischen Ansatz Friedrich Schleiermachers aufgenommen haben.
Gary L.W. Johnson behauptet in seiner Einführung zu dem kürzlich vorgestellten Buch Reforming or Conforming? (Crossway, 2008, ›Introduction‹, S. 15–26), dass zahlreiche post-evangelikale Theologen den erfahrungstheologischen Ansatz Friedrich Schleiermachers aufgenommen haben.
Ich stimme dieser Analyse teilweise zu und stelle zum besseren Verständnis dieses Ansatzes hier einen Auszug aus der Vorlesung über »Apologetik« ein:
Friedrich Schleiermacher (1768–1834)
Die erfahrungstheologische Begründung des Glaubens
Friedrich Schleiermacher (1768–1834) lässt sich bei seinem Versuch, den christlichen Glauben erfahrungstheologisch zu begründen, von apologetischen Interessen leiten. Er stand vor der Aufgabe, nach der von Kant ausgelösten Wende das Christentum auf neue Weise zu begründen. Sein Ansatz wurde von zahlreichen liberalen Theologen, wie z.B. Ritschl (1822–1889), Harnack (1851–1930) oder Troeltsch (1865–1923) – mehr oder weniger – übernommen.
 Während offenbarungskritische oder konservative Theologen bisher gleichermaßen an der Vorstellung festhielten, der Glaube setze sich aus bestimmten Lehraussagen zusammen, knüpfte der späte Schleiermacher in seinem dogmatischen Hauptwerk Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (1. Aufl. 1821/22 u. 2. Aufl. 1830/31) an seine sprachlich besonders demonstrativ in der zweiten Auflage der Reden entwickelte Religionstheorie an. Demnach ist der Glaube wesentlich keine Sache des Verstandes, sondern des Gefühls.
Während offenbarungskritische oder konservative Theologen bisher gleichermaßen an der Vorstellung festhielten, der Glaube setze sich aus bestimmten Lehraussagen zusammen, knüpfte der späte Schleiermacher in seinem dogmatischen Hauptwerk Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (1. Aufl. 1821/22 u. 2. Aufl. 1830/31) an seine sprachlich besonders demonstrativ in der zweiten Auflage der Reden entwickelte Religionstheorie an. Demnach ist der Glaube wesentlich keine Sache des Verstandes, sondern des Gefühls.
Für Schleiermacher steht das fromme Selbstbewusstsein des Menschen, jenes »Bewusstsein schlechthinniger Abhängigkeit« im Zentrum seiner Theologie. Die Glaubenslehre beruht nach Schleiermacher auf zweierlei, »einmal auf dem Bestreben die Erregung des christlich frommen Gemüthes in Lehre darzustellen, und dann auf dem Bestreben, was als Lehre ausgedrückt ist, in genauen Zusammenhang zu bringen«. An die Stelle der Heiligen Schrift tritt das Erleben des Gläubigen. »Der Mensch war das Subjekt seiner Theologie, Gott das Prädikat.« Jan Rohls schreibt dazu:
Gott ist uns also im Gefühl auf eine ursprüngliche Weise gegeben, so daß das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl nicht erst sekundär aus einem Wissen von Gott entsteht. Das Bewußtsein unserer selbst als in Beziehung zu Gott stehend ist daher ein unmittelbares Selbstbewußtsein, nämlich das Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit, das das sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit ausmacht. Und Gott bedeutet zunächst nur dasjenige, was in diesem Gefühl als das mitbestimmende Woher unseres Soseins mitgesetzt ist.
Während bisher Frömmigkeit verstanden wurde als eine subjektive Reaktion auf objektive Lehrinhalte, dreht Schleiermacher die Ordnung um und setzt beim Gemüt an. Die Menschen verstehen die Welt, in der sie leben, durch den Einsatz ihrer Phantasie oder Intuition besser als durch Wissen. Die Glaubensdogmen sind nicht Ursprung, sondern Folge der Glaubenserfahrung. Sätze des Glaubens sind Ausdruck des frommen Gefühls.
Da sich das religiöse Bewusstsein in jedem Menschen findet, also auch bei Gläubigen anderer Religionen, findet man bei Schleiermacher die traditionelle Spannung zwischen dem Christentum und anderen Glaubenssystemen nicht mehr. Religionen werden also auf ihr Entwicklungsstadium befragt, da sie die notwendige Entfaltung des religiösen Bewusstseins spiegeln. Da alle drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) derselben höchsten Entwicklungsstufe der Frömmigkeit angehören, können sie sich nur durch ihre Art der Frömmigkeit unterscheiden. Im Christentum kommt nach Schleiermacher die Frömmigkeit zu ihrer »reifsten Erfüllung«.
Auf diese Weise gelang Schleiermacher die intellektuelle Verteidigung des christlichen Glaubens in einem vom kantianischem Spinozismus geprägten Denkklima. Mit Karl Barth können wir sagen:
Das Christentum wird so interpretiert, daß es in dieser Interpretation, in dem als maßgebend vorausgesetzten Denken der Zeitgenossen ohne durch irgendwelche Kanten anzuecken, Raum bekommt. Ob die Leser diesen Raum beziehen, ob sie die ihnen vorgelegte anstoßfreie Darstellung des Christentums als ihren eigenen Gedanken nach- und mitdenken können und wollen, diese Frage bleibt natürlich offen. Aber das Christentum wird ihnen in einer solchen Gestalt bereitgestellt, daß ein grundsätzliches Hindernis gegen solches Beziehen dieses Raumes … nicht mehr bestehen kann.
Freilich war der Preis für diese »Anpassung« sehr hoch, denn seine evangelische Glaubenslehre war durch damals konsensfähige philosophische Voraussetzungen vereinnahmt worden. Schleiermacher hat – und auch hier können wir uns dem Verdacht des Schweizers Karl Barth anschließen, »die Umdeutung der Theologie in ein Stück allgemeiner Geisteswissenschaft vollzogen«. Schleiermacher verneint eine Autorität jenseits der Glaubenserfahrung, ob nun die der Heiligen Schrift oder die von Bekenntnissen. Zurecht hat er erkannt, dass bloßes intellektuelles Fürwahrhalten von Dogmen kein Glaube ist. Aber er ist so weit gegangen, dass er den Glauben auf die Subjektivität reduzierte.
– – –
Der Text kann (inklusive der Literaturangaben und Anmerkungen) hier als PDF-Datei herunter geladen werden: schleiermacher.pdf.
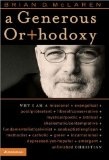
 Kevin DeYoung, Pastor an der »University Reformed Church« und Co-Autor des Buches Why We’re Not Emergent, hat einen eigenen Blog eröffnet:
Kevin DeYoung, Pastor an der »University Reformed Church« und Co-Autor des Buches Why We’re Not Emergent, hat einen eigenen Blog eröffnet: