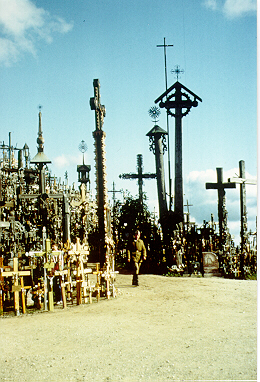Schwang Luther 1517 den Hammer?
Martin Luthers Thesenanschlag von Wittenberg ist sicher der berühmteste, aber längst nicht der einzige: Der Historiker Daniel Jütte hat in der FAZ eine kurze Geschichte des Anschlagens von Zetteln an Kirchen veröffentlicht. Freilich bleiben wichtige Fragen nach wie vor offen.
Staat und Kirche haben eine „Lutherdekade“ ausgerufen, die im Jubiläumsjahr 2017 kulminieren soll. Denn am 31. Oktober 2017 wird sich zum 500. Mal der Thesenanschlag Martin Luthers jähren. Aber hat der Anschlag der 95 Thesen am Hauptportal der Wittenberger Schlosskirche tatsächlich stattgefunden? Die Frage ist bis heute nicht definitiv beantwortet und steht im Mittelpunkt eines seit Jahrzehnten erbittert geführten Streits unter Reformationshistorikern. Nach neueren Schätzungen gibt es nahezu dreihundert Publikationen zu dieser Kontroverse. Es scheint inzwischen fast alles dazu gesagt. Scheint.
Zunächst die Fakten. Luther selbst hat einen Thesenanschlag nie erwähnt. Die Befürworter der Faktizität des Thesenanschlags berufen sich daher vor allem auf ein Zeugnis von Luthers Mitstreiter Philipp Melanchthon sowie auf eine 2006 unter großem Medieninteresse wiederentdeckte Notiz von Luthers Sekretär Georg Rörer. In beiden Dokumenten ist von einem Thesenanschlag die Rede. Historiker, die diesen Quellen glauben, argumentieren, dass beide Berichte den Hergang unterschiedlich erzählen und zudem unabhängig voneinander entstanden sind; Rörers Bericht sogar noch zu Lebzeiten Luthers.
Mehr: www.faz.net.
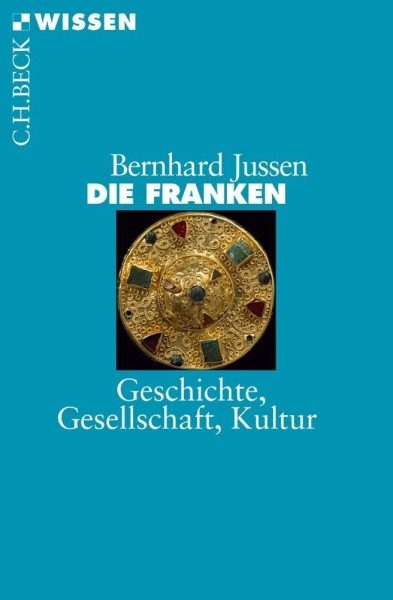 Anders als in Asien war das Töten weiblicher Familienmitglieder im Abendland schon früh verpönt. Historiker finden die Gründe dafür im Christentum und im Wirtschaftssystem.
Anders als in Asien war das Töten weiblicher Familienmitglieder im Abendland schon früh verpönt. Historiker finden die Gründe dafür im Christentum und im Wirtschaftssystem.