Die Liebe siegt? Eine Buchbesprechung über »Love Wins« von Rob Bell
Das Buch Love Wins von Rob Bell schlägt hohe Wellen bevor es überhaupt erschienen ist. Das liegt vor allem an dem hier schon vorgestellten provokativen Videoclip (so erzielt man heute hohe Auflagen). Wer schon mehr von Rob Bell gelesen oder gehört hat, wird von dem Video übrigens kaum überrascht sein können (siehe z.B. hier). Tim Challies, Buchautor und Blogger aus Kanada, hat das Buch bereits gelesen und eine Buchbesprechung verfasst, die ich hier mit freundlicher Genehmigung wiedergebe. Übersetzt wurde die Rezension von Ivo Carobbio, dem ich dafür herzlich danke!
Die Liebe siegt?
Eine Buchbesprechung von Tim Challies über Rob Bells Buch: Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived, HarperOne; Auflage, 224 S.
Fragen zu stellen, ist wichtig. Durch die richtigen Fragen gelangt man zu einem tieferen Verständnis der Wahrheit und wächst in seiner Liebe zu Gott – besonders dort, wo es um die schwierigeren Lehren des christlichen Glaubens geht. Fragen können aber auch dazu missbraucht werden, die Wahrheit zu verschleiern. Sie können genauso leicht dazu verwendet werden, vom rechten Weg wegzuführen als auf ihn hinzuweisen. Eva weiß ein Lied davon zu singen …
Werfen wir einen Blick auf Rob Bell. Er hat in den vergangenen sieben Jahre viel Zeit damit verbracht, in seiner manchmal nachdenklichen und oft entmutigenden Art Fragen zu stellen. Ist er mit seinen Fragen und deren Antworten – egal wie diese ausfallen mögen – zu Ende, bleiben mehr Fragen offen als davor. Diese Tendenz zeigt auch sein neuestes Buch „Love Wins: A Book About Heaven, Hell, and the Fate of Every Person Who Ever Lived“. In diesem Buch stellt Bell seine wohl brisanteste Frage: Schickt ein liebender Gott wirklich Menschen für alle Ewigkeit zur Hölle?
Im Zuge dieser Rezension werden Sie vielleicht Antworten auf Fragen wie diese erwarten: Stimmt es, dass Rob Bell lehrt, so etwas wie die Hölle gebe es gar nicht? Ist es wahr, dass Rob Bell der Ansicht ist, niemand gehe an diesen Ort? Sie werden den Artikel schon zu Ende lesen müssen, denn offen gesagt: Die Antworten auf diese Fragen sind nicht so einfach.
Die Art seiner Fragestellung ist genauso bedeutsam wie die Fragen selbst: „Hat Gott über tausende von Jahren hinweg tatsächlich Milliarden von Menschen geschaffen, um nur einige wenige für den Himmel zu erwählen, während alle anderen ewige Höllenqualen leiden müssen? Wäre das eines Gottes würdig? Wo soll man da von einer ‚guten Nachricht‘ sprechen?“ Es heißt: Wer die Fragen stellt, gewinnt schließlich auch die Debatte. Das trifft insbesondere dort zu, wo ein Gespräch schon zu Anfang durch solche Fragestellungen präformiert wird. Egal, auf welche Seite man sich schlägt – man kann nur verlieren. Das ist nicht böse gemeint; dahinter verbirgt sich auch kein Wortspiel.
„Die gefährliche Zersetzung der Botschaft Jesu“
Bell beginnt sein Buch mit überraschender Offenheit: Die Botschaft Jesu sei zugunsten verschiedenster Erzählungen verdeckt worden, an deren Verkündung Jesus gar nicht interessiert gewesen sei. „Man hat das Eigentliche vergessen. Nun ist es an der Zeit, es wieder zu verkünden“ (Vorwort, vi).
Einer erschreckenden Mehrheit von Menschen ist erzählt worden, dass es nur einer kleinen Anzahl ausgesuchter Christen vergönnt sei, an jenen friedlich-ruhigen und freudevollen Ort zu gelangen, den man ‚Himmel‘ nennt, während der Rest der Menschheit seine Ewigkeit an einem Ort ewiger Qual und Strafe zubringen muss, ohne jemals auf eine Veränderung dieses Zustands hoffen zu dürfen … Diese Aussage ist jedoch fehlgeleitet und schädlich; sie zersetzt letztlich die ansteckende Botschaft Jesu von Liebe, Frieden, Vergebung und Freude, die unsere Welt so dringend hören muss“ (vi).
Lesen Sie dieses Zitat ruhig noch einmal. Sie haben sich nicht verlesen! Rob Bell meint es völlig ernst. Auch, wenn es erst gegen Ende deutlich wird.
„Der Himmel ist ein Ort auf dieser Welt – und wir sind seine Schöpfer“
Bell spricht in seinem Buch viel von Zeit und Raum bzw. von der eigentlichen Bedeutung der biblischen Aussagen über Zeit und Ort von Himmel und Hölle. Er bringt Offenbarung 21 ins Spiel und betont, dass die himmlische Stadt, das Neue Jerusalem schließlich auf die neue Erde herabkommt. Er bekräftigt: Der Himmel ist ein realer Ort, an welchem allein Gottes Wille geschieht; die Vereinigung von Himmel und Erde steht aber noch aus (S. 42f). Das sind Aussagen, die man als Christ wohl kaum in Frage stellen dürfte.
Bell führt seine Argumentation zu folgendem Schluss: Der Himmel wird einst auf die Erde herabkommen; nehmen wir den Himmel wirklich ernst, dann müssen wir auch das gegenwärtige Leiden auf der Welt jetzt ernst nehmen. Wir sind daher aufgerufen, „schon jetzt am künftigen Leben teilzunehmen. Genau das geschieht auch, wenn wir die Zukunft in die Gegenwart ziehen“ (S. 45). Die Rolle der Menschheit wird mit diesen Worten neu definiert: Wir sind nicht so sehr Gottes Verwalter, sondern seine Partner, denn wir „nehmen am noch andauernden Schöpfungsprozess und an der Freude der Welt teil“ (S. 180); wir setzen uns für die Schaffung einer neuen Gesellschaftsordnung mit Jesus ein (S. 77). Wenn er von sozialer Gerechtigkeit spricht, bedient sich Bell gerne der Sprache von Partnerschaft und Teilnahme.
Was ist nun mit der Hölle? Ist die Hölle eine zukünftige Wirklichkeit – oder ist sie nicht vielmehr im Hier und Jetzt? Ist die Hölle ein Ort auf Erden oder doch woanders? Es scheint, als habe die Hölle weniger mit dem zu tun, was wir Gott angetan haben, sondern mehr mit dem, was wir einander antun. Bell liest die Warnungen Jesu vor der göttlichen Strafe so, als richteten sie sich nur an das Zeitliche, nicht an das Zeitliche und an das Ewige. Die Warnungen seien an die Adresse der religiösen Führer von damals gerichtet gewesen und hätten nur sehr wenig mit der Wirklichkeit anderer Zeitalter zu tun, behauptet er (S. 82f). Die Hölle sei „ein Begriff, der das große, weitreichende und schreckliche Übel meint, das aus den geheimen, verborgenen Tiefen unserer Herzlosigkeit kommt und welches sich bis zum überwältigenden, gesellschaftsweiten Zusammenbruch und zum Chaos entwickelt, wenn wir nicht so in Gottes Welt leben, wie er sich das vorstellt“ (S. 95). Nicht mehr von Feuer und vom Zorn ist die Rede; es gibt nichts mehr, was uns nicht innerlich wäre. Leugnet Rob Bell etwa die Existenz der Hölle? Er selbst würde dies verneinen. Die Hölle gibt es, würde er sagen. Allerdings muss er sie vorher umgedeuten. Das aber ist nichts weiter als eine schlaue Form der Leugnung.
Auslegungsakrobatik
Was Bell wirklich glaubt und lehrt, ist nur äußerst schwer ausfindig zu machen. Der Leser sieht sich auf der Spur vieler Fährten, die in verschiedene Sackgassen führen. Jedesmal, wenn Bells Argumente einen kritischen Punkt erreichen, wechselt er das Thema, statt seine Argumente stichhaltig und logisch zu begründen. Einem Kreuzverhör jedenfalls hielte dieses Buch nicht stand. Es zeigt nur wenig Geschlossenheit und innere Stärke.
Dem Leser werden oft langatmige Erklärungen als Fakten verkauft: „Die christlichen Tradition hat seit dem ersten Jahrhundert der Gemeinde mit Nachdruck in den Mittelpunkt gestellt, dass die Geschichte keine Geschichte der Tragik ist und die Hölle nicht für ewig dauert, sondern dass am Ende die Liebe siegt.“ Stimmt das? Das sagt sich leicht. Nur wo bleiben die Beweise? Wieder und wieder verweist Bell auf die Ursprachen, vermeidet es aber, Ausleger zu zitieren oder Quellen anzugeben. Es sagt etwa: „‚Ewig‘ – das ist eine Kategorie, wie sie die biblischen Schreiber so nicht verwendet haben.“ Beweise hält er nicht für nötig. Wie gesagt: So etwas sagt sich leicht, doch wer beweist es uns? Kann es aus rechtmäßigen Quellen erschlossen werden?
Das ganze Buch hindurch unternimmt Bell, was man im besten Fall „Auslegungsakrobatik“ bezeichnen kann, besonders dort, wo er um den Ewigkeitsbegriff (das griechische „aion“) kreist, jenes kleine Wörtchen, das in seiner Argumentation eine zentral Stelle einnimmt.
„Aion“ wird meist mit „ewig“ oder „immerwährend“ wiedergegeben. Bell behauptet, der Begriff könne auch „Zeitalter“, „Zeitdauer“ oder sogar „die Intensität einer Erfahrung“ bedeuten. Für diesen Ansatz verweist er flüchtig auf das Gleichnis von den Schafen und den Böcken (Mt 25,31-46) und bemüht sich zu zeigen, dass die ewige Strafe gar nicht ewig andauere, sondern nur eine intensive Zeit der Sichtung bezeichne.
Doch hier ist der Knackpunkt: In der Tat können die Begriffe „aion“ und „aionos“ für „Zeitalter“ oder „Zeitdauer“ stehen; sie stehen eben aber auch für den Begriff des Ewigen. Erst der Zusammenhang des Textes erlaubt die richtige Deutung. Angenommen, diese Begriffe seien tatsächlich nur mit „Zeitalter“ oder „Zeitdauer“ wiederzugeben: was, wenn wir sie auf Johannes 3,16 anwenden (auch dort steht „aionos“)?
Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verlorengehen, sondern eine Zeitlang das Leben haben.
Das ist nicht sehr ermutigend, nicht wahr? Bell könnte einwerfen, es müsse heißen: „ein Leben in Fülle“ (wodurch an die „Intensität der Erfahrung“ angeknüpft wäre – eine Anspielung auf Johannes 10,10). Was kommt dabei heraus? Wir sehen uns mit einem Glauben konfrontiert, der sich mehr damit befasst, das bestmögliche Leben zu leben, anstatt Jesus nachzufolgen.
Die frohe Botschaft ist mehr
An einigen Stellen des Buches ist Bell durchaus recht zu geben, besonders da, wo er einige unsinnige Theorien zur Sprache bringt, die sich einige Leute zusammengedacht haben, um Gottes absolute Souveränität infrage zu stellen. Doch auch hier sind seine Antworten nicht zufriedenstellend: Selbst seine guten Kritikpunkte führen zu schlechten Schlussfolgerungen.
Bell scheint sich bei seiner Sache seiner Undurchsichtigkeit zu erfreuen. Er mag es, Karikaturen gegensätzlicher Sichtweisen zu erschaffen, die jeglicher Logik und allem Mitgefühl entbehren. Sich selbst stellt er dabei als Opfer hasserfüllter, gefährlicher, ja, giftiger Mitbewohner des Internets dar, die glauben, es sei „die höchste Form von Treue gegenüber Gott, andere anzugreifen, zu verleumden und zu verlästern, die die Glaubensfragen auf andere Art und Weise formulieren als sie selbst“ (S. 185).
Rob Bell macht sich so zum Märtyrer seiner eigenen Sache. Wer ihm widerspricht, wird schon von vornherein mundtot gemacht – eine höchst nützliche Technik, wenngleich man sie kaum als fair bezeichnen kann. Zwischenzeitlich tut er so, als ob jene, die – mit seinen eigenen Worten – glauben, „wir bekommen dieses Leben und nur dieses Leben, um an Jesus zu glauben“ – eine Sichtweise übrigens, der die große Mehrheit der Christen in der Geschichte leidenschaftlich verteidigt hat – nur Rauchwolken erzeugen, statt sich aufrichtig mit der Schrift auseinanderzusetzen. Geschickt definiert er die Fragen und Antworten neu und verrückt dabei die Kampflinien.
Mit dem Versetzen dieser Linien gerät er näher und näher in die Gefahr der Gotteslästerung, etwa wenn er auf 1 Timotheus 2 verweist (wo Paulus sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen). Er reflektiert über die traditionelle (orthodoxe) Sichtweise über die Hölle und fragt:
Wie groß ist Gott? Ist er groß genug, zu erreichen, was er sich vorgenommen hat? Oder ist er nur ein wenig groß, nur meistens groß? Wenn es um das Schicksal von Milliarden Menschen geht, dann erreicht er diese Größe nicht ganz; dann erreicht er nur eine recht bescheidene Größe.
Ein Gott, der es zulässt, dass Menschen wirklich in die Hölle kommen, kann Bell zufolge kein großer Gott sein. Die traditionelle Sichtweise, die besagt, dass er es zulassen wird, ist „verheerend … psychisch erdrückend … erschreckend, traumatisierend und unerträglich“ (S. 136f).
Gott ist bestenfalls „irgendwie“ groß, „ein wenig“ groß – groß darin, einige zu erretten, doch darin böse, andere verlorengehen zu lassen. Das sind gefährliche Worte! Gott Böses zuzuschreiben – da überkommt einen ein Grauen.
Was ist mit der frohen Botschaft? Wo bleibt sie und was macht sie aus? Bell präsentiert uns in seinem Buch ein Evangelium ohne Zweck: Seinem Bibelverständnis nach ist der Mensch im Wesentlichen in Ordnung. Klar sündigen wir, aber wir haben die freie Wahl, Gott zu unseren eigenen Bedingungen zu lieben. Selbst hier noch scheint er zu glauben, dass sich die meisten Menschen Gott zuwenden würden, bliebe ihnen nur genug Zeit.
Hier ist die Liebe!
Wenn „Love Wins“ Bells Sichtweise zu Himmel und Hölle wiedergibt (oder wenigstens unser Verständnis seines Buches seine Sichtweise zu Himmel und Hölle richtig darstellt), dann ist er als Befürworter einer Art „christlichen Universalismus“ entlarvt. Eine solche Etikettierung würde er freilich verneinen, ganz wie er dazu neigt, jede Etikettierung abzulehnen. Das Ganze sieht aus wie eine Ente, quakt wie eine Ente und – naja, Sie wissen ja, wie’s weitergeht.
Sobald den Moslems, Buddhisten und Baptisten aus Cleveland die Tür geöffnet wird, wird es vielen Christen unbehaglich. Sie sagen, Jesus spiele nun keine Rolle mehr, das Kreuz sei nicht länger von Bedeutung und überhaupt könne man glauben, was man wolle und so fort.
Das stimmt aber nicht. Nein, das ist absolut, unmissverständlich und unveränderlich falsch.
Jesus hat gesagt, er und er allein rettet jedermann.
Und dann hat der die Tür weit, weit aufgemacht und alle Arten von Möglichkeiten geschaffen. Er ist so eng wie er selbst und so weit wie das Universum.
…Die Menschen kommen auf den verschiedensten Wegen zu Jesus.
…Manchmal gebrauchen sie dabei seinen Namen; manchmal tun sie’s nicht.
…Manche Menschen empfinden eine solche Last beim Namen „Jesus“; wenn sie dem Geheimnis begegnet, wie es sich überall in der Schöpfung findet – Gnade, Frieden, Liebe, Anerkennung, Heilung, Vergebung –, dann ist das letzte, an das sie zu denken geneigt sind, der Name „Jesus“.
…Wir können beobachten, was Jesus wiederholt tut, und das bei ständiger Erinnerung an den Ernst der Nachfolge und eines Lebens, wie er es gelebt hat und daran, ihm zu vertrauen: Er vergrößert die Möglichkeit und die Reichweite seines Erlösungswerks.
Das ist genau das, was wir unter „Universalismus“ verstehen. Und das gibt Anlass, traurig zu sein. Als Christen brauchen wir nicht noch mehr Verwirrung. Was wir brauchen, ist Klarheit. Wir brauchen Lehrer, die allein das ernst nehmen, was die Bibel sagt, egal wie hart diese Wahrheiten auch sein mögen, und lassen Sie uns ehrlich sein – so manche Wahrheiten sind nun mal sehr, sehr schwer zu schlucken.
Ja, die Liebe wird siegen, aber nicht diese Art von Liebe, über die Bell in seinem Buch spricht. Denn diese Liebe gründet allein in der Ansicht, der Mensch sei der Hauptgegenstand der Liebe Gottes. Die ganze Geschichte kann – so Bell – in folgenden Worten zusammengefasst werden: „Denn so sehr liebte Gott die Welt.“ Eine solche Liebe kann jedoch der wunderbaren Liebe Gottes, wie die Bibel sie uns offenbart, nicht das Wasser reichen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der „seine Liebe zu uns dadurch beweist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren“ (Röm 5,8), der sich nicht so sehr deshalb für uns einsetzt, weil seine Liebe zu uns so groß ist, sondern weil er so groß ist (Jes 48,9; Ez 20,9.14.22.44; 36,22; Joh 17,1–5).
Das ist die Liebe, die siegt! Das ist die Liebe, die uns bewegt, unseren Nächsten genug zu lieben, um ihn zu drängen, dem kommenden Zorn zu entfliehen. Unsere Liebe für die Menschen bedeutet gar nichts, wenn wir nicht zunächst und zumeist Gott genug lieben, um die Wahrheit über ihn zu sagen.
Tim Challies, am 3. März 2011
Dieser Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors von Ivo Carobbio übersetzt. Tim Challies ist über seinen Blog erreichbar: Challies_on_Love_wins.pdf.
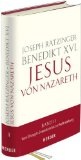 Morgen erscheint der zweite Teil des
Morgen erscheint der zweite Teil des