Horst Georg Pöhlmann (Das Glaubensbekenntnis, 2003), S. 16:
Gott ist nicht, wie F. Nietzsche meinte, der Gegenbegriff zum Leben[,] sondern Inbegriff des Lebens und die Quelle allen Lebens (Psalm 36,10).
Horst Georg Pöhlmann (Das Glaubensbekenntnis, 2003), S. 16:
Gott ist nicht, wie F. Nietzsche meinte, der Gegenbegriff zum Leben[,] sondern Inbegriff des Lebens und die Quelle allen Lebens (Psalm 36,10).
Jürg Altwegg skizziert in seinem FAZ-Beitrag „Die Tyrannei der Tugendhaften“ die Kritik des französischen Philosophen Pierre-André Taguieff am Postmodernismus. Interessant dabei ist, dass sich auch der russische Nationalist Alexander Dugin bei der französischen Postmoderne bedient, um den Umsturz der Diktatur des Westens zu fördern. Jürg Altwegg schreibt:
Der Ideenhistoriker Pierre-André Taguieff deutet den „militanten und ideologisierten Hass auf die europäische Kultur“, den Woke predige, als „Diabolisierung des Westens“. Die „Dekonstruktion“ führt er auf den Einfluss von Heidegger und Nietzsche in Frankreich zurück. Taguieff kennt die philosophische und politische Wirkungsgeschichte der französischen Postmoderne in beiden Ländern. „Black Lives Matter wurde 2013 von drei militanten Marxistinnen begründet“, hält er in „Pourquoi déconstruire?“ fest. Aus dem Antirassismus wurde ein Rassismus. Die Umschreibung der Geschichte belegt er mit dem Hinweis auf Historiker, die den Anfang der Demokratie nicht in Athen, sondern in Afrika situieren. Woke versteht Taguieff als Wiedergeburt der „revolutionären Utopie“.
Nebenbei weitet er seine Darstellung auf den russischen Nationalisten und Ideologen Alexander Dugin aus. Dugin kennt die französische Postmoderne und zitiert ihre Autoren. Die Dekonstruktion der westlichen Hegemonie unterstützt er laut Taguieff „ohne Einschränkung“. Sie entspricht dem Willen „zum Umsturz der Diktatur des Westens“. Dugin benutzt das „Arsenal der postmodernen Kritik“. Verworfen aber wird das von Woke angerichtete „allgemeine Chaos“ mit der „Umkehrung der Hierarchie“ und der „Auflösung ihrer Komponenten“: Geschlecht, Wissen, Gesellschaft, Politik.
Mehr (hinter einer Bezahlschranke): https://www.faz.net.
David Bell arbeitete früher als leitender Arzt in der Londoner Transgender-Klinik „Tavistock“. Dann enthüllte der Psychoanalytiker, wie dort Kinder ohne vorherige Beratung Hormontherapien ausgesetzt wurden. Bell war kürzlich in Berlin und hat in einem Vortrag über seine Beobachtungen berichtet.
Er erzählt von der Zeit, als die Tavistock-Klinik noch einen guten Ruf hatte – und die Gesamtzahl der minderjährigen Patienten auf fünfzig Kinder und Jugendliche beschränkt war. Dann, innerhalb weniger Jahre, habe sich die Zahl der minderjährigen Patienten auf über 3000 vervielfacht. Die Bedürfnisse der Kinder hätten keine Rolle mehr gespielt, die psychoanalytische Tradition der Klinik sei unter die Räder gekommen, Diskussionen hätte es nicht mehr gegeben, immer mehr Ärzte hätten gekündigt. Und die Klinik habe massiv am Verschreiben von Geschlechtshormonen verdient.
Nathan Giwerzew, der den Vortrag von Bell gehört hat, berichtet:
Bells Vortrag lässt sich im Wesentlichen an drei Schwerpunkten festmachen. Erstens sei Freuds Begriff des Unbewussten in der gegenwärtigen Psychoanalyse einem beispiellosen Angriff ausgesetzt, so Bell. Wer zu bedenken gebe, dass der Transitionswunsch eines Kindes auf unbewusste Konflikte verweise, der werde aus dem Diskurs ausgeschlossen. Denn die „Trans-Lobby“ habe dafür gesorgt, dass jeder Zweifel als „Ketzerei“ verteufelt werde. Zweitens habe sich bei vielen Ärzten die Auffassung durchgesetzt, komplexe psychische Probleme wie beispielsweise Depressionen bei Kindern ließen sich ganz einfach dadurch lösen, dass sie den Kindern Pubertätsblocker oder gegengeschlechtliche Hormone geben. Und drittens sei der Trend erkennbar, dass es weitaus mehr Mädchen geben würde, die zu Jungen werden wollten als umgekehrt. Das habe vor allem gesellschaftliche Gründe.
Mehr (hinter einer Bezahlschranke): www.welt.de.
Das Anliegen der sogenannten Postevangelikalen ist es, die Theologie und das Verständnis des persönlichen Glaubens innerhalb der evangelikalen Kreise zu reformieren. Weiterglauben ist das Schlagwort. Christen sollen aus der geistlichen Enge hinaus ins weite Land einer anschlussfähigen Spiritualität geführt werden (vgl. Was sind Postevangelikale?).
In seinem aktuellen Buch Wenn der Glaube nicht mehr passt hat Martin Benz in diesem Sinne seinen eigenen Umzug aus einer rückwärtsgewandten Frömmigkeit ins Progressive beschrieben. Peter Bruderer hat sich die Mühe gemacht, den Umzugshelfer von Martin Benz zu lesen und eine Rezension verfasst, die ich gern empfehle. Darin heißt es:
Wenn Martin Benz also ein Buch vorlegt mit dem Titel «Wenn der Glaube nicht mehr passt», dann vermute ich schon da ein grundlegendes Missverständnis, dem auch andere Gläubige erliegen: Der Glaube ist nicht dazu gedacht, dass er uns passt, sondern dass wir lebenslang mehr und mehr in ihn hineinwachsen. Nicht der Glaube muss sich weiterentwickeln, sondern wir müssen es. Wer einen Glauben sucht, der ihm passt, hat nicht begriffen, dass der biblisch-traditionelle christliche Glaube keine «Wohnung» ist, sondern ein Universum.
Ich werde in meinen Erörterungen um der Verständlichkeit willen primär mit dem Bild agieren, das Martin gewählt hat: Das Bild der Wohnung und des Umzugs. Dabei will ich schon zu Beginn meine Schlussfolgerung nennen, damit dies beim Lesen meines Textes mitbedacht werden kann: Ich werde den Umzug nicht mitmachen, den mir Martin nahelegt. Die Wohnung, die er mir schmackhaft macht, ist aus meiner Sicht weder so neu, wie sie den Anschein macht, noch hat sie die nötige Bausubstanz, die ich für meine Wohnung wünsche. Sie ist mir viel zu klein.
Lieber Leser: Vielleicht bist du an einem anderen Punkt als ich. Vielleicht überlegst du es dir, mit Martin einen (wie auch immer gearteten) Umzug des Glaubens in ein anderes Haus mitzumachen. In diesem Fall habe ich einen Wunsch. Ich hoffe, dass du trotz der Tatsache, dass ich den Umzug nicht mitmache, meine Gedanken, Argumente und Rückfragen an Martin ernsthaft in Betracht ziehst. Wer weiss, vielleicht entdeckst du in den Antworten, die du findest, Hinweise auf das Universum, das Gott vor unseren Augen aufspannt.
Hier mehr: danieloption.ch.
 Die nächste Hauptkonferenz von Evangelium21 wird vom 20.–22. April wieder in der Arche-Gemeinde in Hamburg stattfinden. Hauptredner sind in diesem Jahr Mark Dever und Mack Stiles. Die Beiden werden, neben weiteren deutschsprachigen Rednern, das Thema „Ihr werdet meine Zeugen sein” beleuchten.
Die nächste Hauptkonferenz von Evangelium21 wird vom 20.–22. April wieder in der Arche-Gemeinde in Hamburg stattfinden. Hauptredner sind in diesem Jahr Mark Dever und Mack Stiles. Die Beiden werden, neben weiteren deutschsprachigen Rednern, das Thema „Ihr werdet meine Zeugen sein” beleuchten.
Weitere Informationen zum Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier: www.evangelium21.net.
Herman Bavinck schreibt (Reformed Dogmatics: God and Creation, Bd. 2, S. 56–57):
Nun ist die Tatsache, dass die Welt die Bühne der Selbstoffenbarung Gottes ist, kaum zu leugnen. Daran lässt die Heilige Schrift zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel aufkommen. Sie errichtet keinen Altar für den unbekannten Gott, sondern verkündet den Gott, der die Welt geschaffen hat (vgl. Apg 17,23–24), dessen Macht und Gottheit vom menschlichen Verstand in den geschaffenen Dingen deutlich wahrgenommen werden kann (vgl. Röm 1,19–20), der vor allem die Menschen nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen hat (vgl. Gen 1,26), als seine Nachkommen, die in ihm leben und sich bewegen (vgl. Apg 17,28). Er hat zu ihnen durch Propheten und Apostel gesprochen, vor allem durch seinen Sohn selbst (vgl. Hebr 1,1), und offenbart sich ihnen nun ständig (vgl. Mt 16,17; Joh 14,22-23 usw.). Nach der Heiligen Schrift ist das ganze Universum eine Schöpfung und damit auch eine Offenbarung Gottes.
In einem absoluten Sinn ist also nichts atheistisch. Und dieses Zeugnis der Heiligen Schrift wird von allen Seiten bestätigt. Es gibt keine atheistische Welt. Es gibt keine atheistischen Völker. Es gibt auch keine atheistischen Personen. Die Welt kann nicht atheistisch gedacht werden, denn dann könnte sie nicht das Werk Gottes sein, sondern müsste die Schöpfung eines Anti-Gottes sein.
Norbert Bolz sucht in einem Beitrag für DIE WELT nach einer Erklärung für die schwindende Meinungsfreiheit und sieht eine Ursache für das Phänomen des Konformismus interessanterweise in der Aufklärung:
Dass die Menschen sich ihres eigenen Verstandes ohne Anleitung anderer bedienen würden, wenn man sie erst einmal von den Dogmen der Religion und den Vorurteilen der Tradition befreit hat, war der Trugschluss der Aufklärung. Gerade der moderne Konformismus des Denkens ist eine Konsequenz der Entmythologisierung, der Entzauberung der Welt – also eine Nebenwirkung der Aufklärung. Wir sagen, was man sagt, weil wir uns nicht mehr vom Gesetz, der Sitte und der Tradition getragen fühlen.
Diese modernitätsspezifische Anomie [bezeichnet in der Soziologie den Zustand fehlender oder schwacher sozialer Normen, Regeln und Ordnungen; Anm. R.K.] führt also geradewegs zum Konformismus: Die Emanzipation der Vernunft hat uns der öffentlichen Meinung versklavt. Und es ist vor allem die Emanzipation der Vernunft von der Tradition, die ein Orientierungsvakuum geschaffen hat, das die Gewalt der öffentlichen Meinung unwiderstehlich macht. Alle reden von Individualität, Diversität und Selbstverwirklichung – und alle denken dasselbe. So entsteht der Konformismus des Andersseins. Sie alle sind Schauspieler des Nonkonformismus auf der Bühne des Konformismus.
Mehr (allerdings hinter einer Bezahlschranke): www.welt.de.
Vermutlich wird es etlichen Lesern des Blogs auf die Nerven gehen, dass ich hier immer wieder etwas zum Thema „Soziales Geschlecht“ publiziere. Ich selbst finde es auch langweilig. Aber da vor allem unseren Kindern in vielen Schulen und Medien ein neues Fühlen eingeimpft wird, werde ich auch in Zukunft dranbleiben.
Heute stelle ich das Video „Drittes Geschlecht? 11 Fakten über Gender“ ein, das mit den Einnahmen der Rundfunkbeiträge produziert wurde und junge Leute über das Geschlecht aufklären soll.
Der Beitrag transportiert – ich möchte es so drakonisch formulieren – fast nur „alternative Wahrheiten und Fakten“. Kinder und Jugendliche werden das aber nur merken, wenn wir mit ihnen darüber reden und darauf hinweisen, was hier alles FakeInfos sind. Denn es gibt eine wahrscheinlich unausgesprochene Übereinkunft zwischen den Ministerien, Medienhäusern, Konzernen und Instituten, die allesamt das neue Fühlen einführen möchten und auf ihren Kanälen in das gleiche Horn blasen.
Achtung: Wer anders darüber denkt als der Jugendkanal Funk, muss sich darauf gefasst machen, dass er versehentlich eine Gabel in den Oberschenkel gerammt bekommt.
Peter J. Williams nennt zehn Gründe, die dafür sprechen, die Bibel in ihren originalen Sprachen zu lesen. Dazu gehört:
Wenn man die Heilige Schrift nicht in der Originalsprache liest, entgehen einem möglicherweise wichtige Aspekte und man merkt noch nicht einmal, dass sie einem entgehen. Wusstest du beispielsweise, dass du dich in einer guten Tradition mit der Bibel befindest, wenn du in deinen Predigten Alliterationen (ein literarisches Stilmittel, bei dem Wörter dieselben Anfangslaute haben, Anm. d. Übers.) verwendest? In den deutschen Übersetzungen kommt das nicht zum Ausdruck, doch Jesus begann die ersten vier Seligpreisungen in Matthäus 5,3–6 tatsächlich mit demselben Buchstaben. Es gibt Tausende von Sachverhalten, die im Original eigentlich klar sind, die aber jemand, der die Texte in einer Übersetzung liest, schlichtweg nicht erkennen kann.
Mehr: www.evangelium21.net.
Das Markusevangelium überliefert uns folgenden kurzen Dialog (Mk 9,38–49):
Johannes sprach zu ihm: Meister, wir sahen einen, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten’s ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach: Ihr sollt’s ihm nicht verbieten. Denn niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.
Was ist hier passiert und was dürfen wir aus diesem Gespräch zwischen Jesus und Johannes lernen? Ich will versuchen, beide Fragen kurz zu beantworten:
Johannes, Sohn des Zebedäus und einer der zwölf Jünger (vgl. Mk 1,19–20), berichtet seinem Lehrer (griech. didaskalos) von einem Mann, der im Namen Jesu Dämonen ausgetrieben hat. Da er nicht zu ihnen gehörte, haben sie ihm freilich untersagt, weiterhin im Namen ihres Meisters böse Geister auszutreiben. Jesus ist davon nicht begeistert, sondern erwidert: „Hindert ihn nicht! Denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“ (NGÜ).
Oberflächlich betrachtet könnte man meinen, dass zwischen dem vorangehenden Abschnitt in Mk 9,33–37 und diesem Austausch in 9,38–49 kein gedanklicher Zusammenhang besteht. Tatsächlich wurde schon vermutet, dass der Apostel wegen des Tadels, den die Zwölf gerade erhalten hatten, den Vorfall mit dem Exorzisten nur einfügte, um schnell das Thema zu wechseln. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass das Gewissen des Johannes wegen der Ermahnung („Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener.“) aufgewühlt wurde und dieser nun wissen wollte, ob er und die anderen sich gegenüber diesem fremden Wundertäter richtig verhalten hatten.
Was für ein Mann ist das überhaupt, von dem Johannes hier spricht? Es handelt sich nicht um einen „Möchtegern-Exorzisten“ wie es etwa die sieben Söhne des jüdischen Hohenpriesters mit dem Namen Skeva waren (vgl. Apg 19,13–16). Er war auch kein „gesetzloser Exorzist“ im Sinne von Mt 7,22–23. Wahrscheinlich ist, dass der Mann, von dem Johannes spricht, wirklich glaubte, dass Jesus der verheißene Messias ist. Allerdings hatte er keine Beziehung zum engeren Jüngerkreis aufgebaut, sondern lebte und wirkte unabhängig von den Zwölfen. Johannes begründet daher den Versuch, ihn auszubremsen, damit, „dass er uns nicht folgte“. Bei Lukas klingt es ein wenig anders. Dort lesen wir: „denn er folgt dir nicht nach mit uns“ (Lk 9,49). Aber sowohl bei Markus als bei Lukas scheint der Schwerpunkt darauf zu liegen, dass dieser Exorzist nicht zum Jüngerkreis gehörte.
Was Jesus meint, wenn er sagt: „Niemand, der ein Wunder tut in meinem Namen, kann so bald übel von mir reden“, ist ziemlich klar. Wenn jemand im Namen Jesu – d.h. in Übereinstimmung mit seinem Willen und in seiner Vollmacht – ein mächtiges Werk vollbringt, wird er nicht schlecht von demjenigen reden, den er als den eigentlichen Auslöser dieses Wunders anerkennt. Deshalb ergänzt Jesus: „Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ (Man beachte, dass Jesus sich hier mit den Jünger eins macht und explizit von „wir“ anstelle von „ich“ spricht.)
Was sollen wir nun aus diesem kleinen Abschnitt lernen?
Erstens warnt uns Jesus vor einem „Exklusivismus“. Wenn wir meinen, dass nur unter uns „echte Jesusjünger“ zu finden sind oder sich alle ernsthaften Christen unserer Gemeinde anschließen sollten, dann wirkt unter uns bereits dieser toxische elitäre Geist, vor dem Jesus hier warnt.
Zweitens – und dieser Punkt ist mit dem ersten verwandt – sieht es ganz so aus, als ob sich Johannes und seine Freunde sehr wichtig genommen haben. Tatsächlich könnte es hier eine Verbindung zu dem vorangehenden Abschnitt geben. Die Zwölf hielten sich für die „Größeren“ (vgl. Mk 9,34). Sie waren schließlich – so ihre Überzeugung – viel näher an Jesus dran und nur bei ihnen ist echte Vollmacht über das Böse zu finden. Jesus macht folglich mit seiner Antwort deutlich, dass Stolz und eine dienende Haltung nicht zusammenpassen. Hans Bayer schreibt in seinem Kommentar: „Beachtenswert ist ferner die Wendung er folgt(e) uns nicht nach; weist dies darauf hin, dass sie sich aufgrund der wachsenden Popularität Jesu wichtig vorkommen?“ (Hans Bayer, Das Evangelium des Markus, HTA, 2018, S. 349).
Drittens zeigt uns Jesus mit seiner Reaktion, dass jemand, der in seinem Namen spricht und handelt, nicht so schnell gegen Jesus und seine Jünger polemisieren wird. Es spricht viel dafür, eine gewisse Toleranz oder sogar Wohlwollen gegenüber jenen zu kultivieren, die anders als wir selbst doch das eine Evangelium weitertragen, sogar dann, wenn die Motive zwielichtig sein mögen (vgl. Phil 1,17–18). William Hendriksen, von dem ich hier viel „abgekupfert“ habe, schreibt (Exposition of the Gospel According to Mark, NTC, S. 360–361):
Seien wir nicht weniger weitsichtig als Paulus (Phil 1,14–18). Folgen wir der Lehre Jesu und reichen wir unter Wahrung dessen, was wir selbst für die Reinheit der Lehre halten, all jenen die Hand der Brüderlichkeit, die den Herrn Jesus Christus lieben und auf das feste Fundament seines unfehlbaren Wortes bauen. Indem wir dies tun, lasst uns beten, dass wir dazu beitragen, andere auf den Weg des Heils zu führen, zur Ehre Gottes (1Kor 9,19.22; 10,31.33).

Die Logos-10-Pakete gibt es noch eine Woche reduziert. Weil immer wieder Fragen bezüglich der Inhalte gestellt wurden, hat das Logos-Team für die deutschsprachige Version eine Vergleichsseite für die Funktionen der Bibel-Software angelegt.
Zur Vergleichsseite geht es hier: de.logos.com.
Die neuen Höllenpredigten kommen aus dem Lager der Klimaschützer. Die radikalen Weltretter malen endzeitliche Szenarien an die Wand, um illegale Mittel zu heiligen, meint Martin Grichting in einem Artikel, den er für die NZZ geschrieben hat. Wo der Glaube an das Evangelium schwindet, macht sich eine überschätze und repressive Zivilreligion breit:
Angesichts der Bedrohungen durch die Welt, die auch menschengemacht sein können, soll der Christ sein Mögliches tun, aber immer im Rahmen dessen, was ihm zusteht, weil er stets auf Gottes Wegen gehen soll. Das hebt sich ab vom Zwanghaften wider- und postchristlicher Ideologien, die mit eigenen Kräften und nicht selten gewaltsam versuchen, das Elysium zu schaffen.
Vor diesem Hintergrund muss man die gegenwärtige klimareligiöse Welle als Absage an das Christentum deuten. Von Bismarck stammt das Diktum: «Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt.» Heute scheint es umgekehrt: Man fürchtet zwar Gott nicht mehr, aber dafür so ziemlich alles andere auf der Welt. Das Fürchten ist gegenwärtig der grosse Treiber. Hans Jonas hat es «zur ersten, präliminaren Pflicht einer Ethik geschichtlicher Verantwortung» erklärt.
Vergröbert bei Greta Thunberg heisst das: «Ich will, dass ihr in Panik geratet, dass ihr die Angst spürt, die ich jeden Tag spüre.» Dies ist kein Ausweis christlicher Gottesfurcht, sondern diesseitiger Zukunfts- und Todesfurcht. Das dadurch geschaffene Klima ist geeignet, den Boden für freiheitsentziehende oder gewalttätige Vorgehensweisen zu bereiten. Bei Jonas ist das schon vorgedacht, wenn er zur «Kupierung von Produktionskapazitäten» schreibt: «freiwillig, wenn möglich, erzwungen, wenn nötig».
Mehr: www.nzz.ch.
Die Redakteurin Anno Dobler weiß, was es heißt, Ziel eines Shitstorms zu werden. Der Druck auf Redaktionen und Journalisten wächst, da Aktivisten, linke wie rechte, zur Treibjagd auf Autoren aufrufen. Mit einem gewissen Abstand zu den eigenen Erfahrungen hat sie über die Dynamiken eines Shitstorms reflektiert:
Sie bauen sich schnell auf und ergießen sich in einer Empörungslava mit gewaltiger Wucht. Fast kein Tag vergeht mehr, ohne dass in digitalen Plattformen, vorzugsweise auf Twitter, irgendwer Ziel eines Shitstorms wird. Oft verebben die Empörungsstürme nach kurzer Zeit ohne größeren Widerhall in der analogen Welt, weil das Ziel zu irrelevant, zu wenig greifbar oder generell zu unantastbar ist.
Komplexe Organisationen wie Fernsehsender oder Zeitungen sind in Summe schwerer zu treffen, weswegen sich die digitale Empörung vor allem gegen einzelne Mitarbeiter richtet, die als nicht sattelfest identifiziert worden sind: freie Mitarbeiter, Kolumnisten, externe Autoren etwa. Aber auch Vertreter politischer Parteien sind betroffen, wenn sie nicht an vorderster Front stehen.
Beispiele gibt es in jüngster Zeit ausreichend, so dass man längst nicht mehr von Einzelfällen sprechen kann. Jeder erfolgreiche Schachzug motiviert freilich jene, die ihn initiiert haben, zu immer neuen, immer heftigeren Reaktionen. Die Dynamik darf nicht verlorengehen.
Aus demokratiepolitischer Sicht ist das eine hochproblematische Entwicklung. Denn es muss in jedem Fall klar unterschieden werden: Handelt es sich hier um eine berechtigte Empörung, weil nicht nur die guten Sitten, sondern vor allem die Grenzen der Meinungsfreiheit grob verletzt worden sind, oder geht es hier lediglich um subjektiv verletzte Gefühle?
Ein guter Gradmesser sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Denn die Justiz kann zweifellos anhand objektiver Kriterien feststellen, ob eine Aussage noch innerhalb der gesetzlichen Grenzen liegt.
Mehr: www.corrigenda.online.
Sind Evangelikale (Männer) partout patriarchalische Machos, wie das irgendwie Kristin Kobes Du Mez’ Buch Jesus and John Wayne kommuniziert? Ich empfehle, mitzulesen, was Matt Studer darüber denkt:
Was geschieht, wenn plötzlich alles patriarchal überschattet wird? Ich behaupte, dass die Schablone, mit der Du Mez die Evangelikalen liest, wenig Differenzierung zulässt. Es ist eine Schablone, die vorbestimmt was am Ende rauskommt. Folgende Beobachtungen sollen dies verdeutlichen. Du Mez bespricht die Formierung des sogenannten Council for Biblical Manhood and Womanhood (CBMW) als ‚einen Versuch, das Patriarchat auf der Grundlage der Bibel zu verteidigen‘. (S. 166) Sie nimmt Bezug auf das Danvers Statement (eines Grundlagenpapiers, das die Hauptgedanken des CBMW zusammenfasst): ‚[Dieses Papier] diktierte, dass die Leitung des Mannes [in der Ehe, gemäss Epheser 5] demütig und liebend anstatt dominierend sein solle. Und es hielt fest, dass „Männer von einer harten und eigennützigen Führung in der Ehe absehen und ihre Frauen lieben und für sie sorgen sollen“‚. (S. 167) Obwohl eine dienende, fürsorgliche ‚Autorität‘ sicher besser ist als der chauvinistische Habitus eines John Wayne im Umgang mit Frauen, das Problem für Du Mez ist hier das Paar ‚Führung – Unterordnung‘ (gemäss der Auslegung des CBMW der Epheser-5-Stelle). Natürlich kann man heute, in unserer modernen Welt, die nur noch wenige oder keine Unterschiede mehr zwischen Mann und Frau sieht, über diese und ähnliche paulinische Stellen denken was man will. Aber dass hier Paulus (oder vielleicht besser das Verständnis des CBMW von Paulus) und Mr. Wayne über den gleichen Kamm geschoren werden ist bedenklich. Die Unterschiede zwischen einem chauvinistischen Machoismus, der Frauen als Objekte sieht über die er herrscht, und einer fürsorglichen, dienenden ‚Autorität‘ sind himmelweit. Doch wer nur ansatzweise über eine Möglichkeit unterschiedlicher Rollen aufgrund des Geschlechts nachdenken will, landet bei Du Mez automatisch im patriarchalischen Lager.
Mehr: www.mindmatt.com.
Heute eine Ankündigung in Sachen Verlag Verbum Medien: Einige Bücher können inzwischen als Logos-Editionen vorbestellt werden! Unter den genannten Titeln in dieser Mail befinden sich zwei kostenfreie, vorbestellbare Artikel und neue Schätze. Einige davon sind noch kurze Zeit stark reduziert, bis sie in Logos verfügbar werden.
Darunter:
Tim Keller: Galater: Kommentar und Arbeitsheft (Die Bibel erklärt, 2 Bde.)
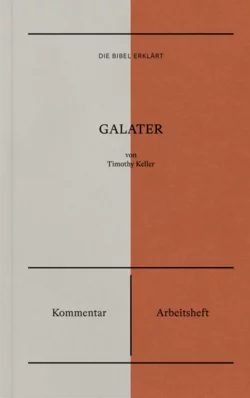 Das Evangelium verändert unser ganzes Leben, zeigt Timothy Keller in dieser Auslegung des Galaterbriefes. Der Kommentar ist nicht akademisch ausgerichtet. Er macht den Galaterbrief zugänglich und bietet relevante Anwendungen für unser Leben. Er kann wie jedes andere Buch von vorne bis hinten gelesen werden, für die Stille Zeit verwendet werden, zur Predigtvorbereitung genutzt werden oder um Hauskreise anzuleiten. Neben dem Kommentar liegt ein Arbeitsheft für Gruppen und Leiter vor, um das Buch in einer Kleingruppe zu studieren.
Das Evangelium verändert unser ganzes Leben, zeigt Timothy Keller in dieser Auslegung des Galaterbriefes. Der Kommentar ist nicht akademisch ausgerichtet. Er macht den Galaterbrief zugänglich und bietet relevante Anwendungen für unser Leben. Er kann wie jedes andere Buch von vorne bis hinten gelesen werden, für die Stille Zeit verwendet werden, zur Predigtvorbereitung genutzt werden oder um Hauskreise anzuleiten. Neben dem Kommentar liegt ein Arbeitsheft für Gruppen und Leiter vor, um das Buch in einer Kleingruppe zu studieren.
Die Auslegungsreihe Die Bibel erklärt macht die Bücher der Bibel zugänglich und bietet relevante Anwendungen für unser Leben. Die Kommentare sind für die persönliche Lektüre, für die Stille Zeit und für den Hauskreis geeignet.
Vorbestellung: de.logos.com.
Carl Trueman: Der Siegeszug des modernen Selbst
 Die moderne Kultur wird zunehmend von Fragen und Antworten rund um die sexuelle Identität beeinflusst – ob im öffentlichen Diskurs oder bei kulturellen Trends. Jedes gesellschaftliche Phänomen hat seine historischen Wurzeln. Von Augustinus, über Rousseau bis hin zu Marx oder Freud sind unterschiedliche Auffassungen des Selbst vorgestellt worden. Im 20. Jahrhundert wurden diese Konzepte des Selbst nicht nur psychologisiert und eng mit der Sexualität verschränkt, sondern unter dem Einfluss von Leuten wie Reich, Marcuse und anderen ebenfalls zu einer politischen Angelegenheit gemacht.
Die moderne Kultur wird zunehmend von Fragen und Antworten rund um die sexuelle Identität beeinflusst – ob im öffentlichen Diskurs oder bei kulturellen Trends. Jedes gesellschaftliche Phänomen hat seine historischen Wurzeln. Von Augustinus, über Rousseau bis hin zu Marx oder Freud sind unterschiedliche Auffassungen des Selbst vorgestellt worden. Im 20. Jahrhundert wurden diese Konzepte des Selbst nicht nur psychologisiert und eng mit der Sexualität verschränkt, sondern unter dem Einfluss von Leuten wie Reich, Marcuse und anderen ebenfalls zu einer politischen Angelegenheit gemacht.
Der Historiker Carl Trueman untersucht in seinem Buch Der Siegeszug des modernen Selbst die Sichtweisen auf „Selbst“, die schlussendlich zur sexuellen Revolution beigetragen haben und seitdem tief in unsere Alltagskultur eingeschrieben sind. Er greift dabei auf Analysen des Philosophen Charles Taylor, des Soziologe Philip Rieff und des Ethikers Alasdair MacIntyre zurück. Trueman gibt einen äußerst hilfreichen Überblick über die Vergangenheit, bringt Klarheit in die Gegenwart und vermittelt Orientierungs- und Argumentationshilfen im Blick auf die Zukunft. Für Christen, die sich in der Kultur einer sich ständig verändernden Suche nach Identität bewegen und bewähren müssen, ist das ein wichtiges Werk.
Vorbestellung: de.logos.com.
Dane Ortlund: Tiefer: Wie Christen echte Veränderung erleben
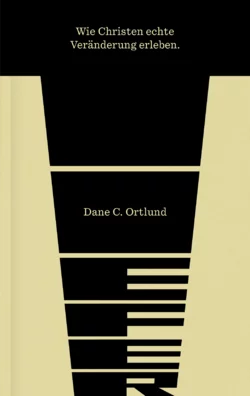 Wie können Christen wachsen? Kaum jemand stellt infrage, dass die Bibel uns dazu aufruft, in unserem Glaubensleben zu wachsen. Aber die Erklärung, wie das genau vor sich gehen soll, ist oftmals vage.
Wie können Christen wachsen? Kaum jemand stellt infrage, dass die Bibel uns dazu aufruft, in unserem Glaubensleben zu wachsen. Aber die Erklärung, wie das genau vor sich gehen soll, ist oftmals vage.
Dane Ortlund lenkt den Blick der Gläubigen auf Christus. Er macht deutlich, dass der Weg der Heiligung nicht darin besteht, mehr zu tun oder besser zu werden, sondern tiefer in die wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums einzutauchen, die für uns gelten, seit wir mit ihm vereint wurden.
Dabei stützt sich Ortlund auf den Erkenntnisschatz von Persönlichkeiten aus der gesamten Kirchengeschichte. Er ermutigt seine Leser, im Kampf gegen die Sünde auf Jesus zu sehen, sich auf seine Gnade zu stellen und ihre unbesiegbare Identität in Christus auszuleben.
Vorbestellung: de.logos.com.