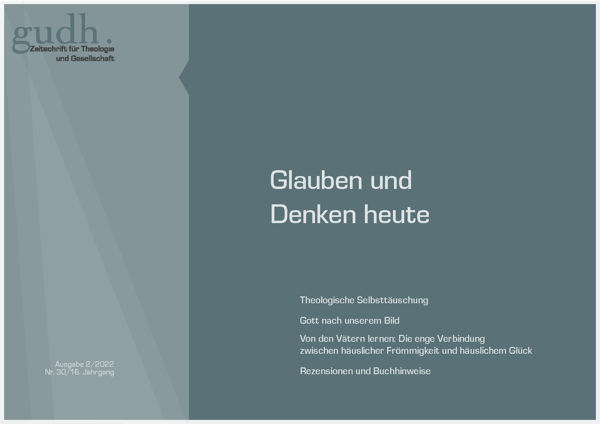Tiefe Freundschaften sind sehr kostbar. Manche wäre froh, wenn sie überhaupt Freunde hätten; sogar in der Gemeinde. Andreas Dück, Pastor in der Freien Kirchengemeinde Warendorf, hat einen sehr hilfreichen Artikel zum Thema „Warum finde ich in der Gemeinde keine Freunde?: Wie das Evangelium unseren Blick auf Freundschaft prägt“ verfasst. Darin heißt es:
Den ersten Entwurf eines Artikels über Freundschaften in der Gemeinde schrieb ich 2010. Wir waren damals eine Gemeinde mit ca. 80 Mitgliedern – die meisten zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ich nahm wahr, dass nicht gelingende Freundschaften immer wieder zu Reibungen und Konflikten führten. Als ich meinen Artikel einigen Testlesern zuschickte, bewogen ihre Rückmeldungen mich dazu, ihn nicht zu veröffentlichen. Es war ein zu heißes Eisen. Mein Entwurf schien nicht geeignet zu sein, das Thema in rechter Weise anzupacken. Die Sehnsucht nach Freundschaften ist tief im Herzen verankert und ähnlich wie die Sehnsucht nach ehelicher Partnerschaft mit vielen Erwartungen beladen.
Dabei scheint die Gemeinde der ideale Ort für Freundschaften zu sein. Das Liebesgebot, die Anweisung, den anderen höher zu achten als sich selbst, die Aufforderung zur Vergebung, das Vorbild der Selbstaufgabe und die Voraussetzung eines bekehrten Herzens sind doch ideale Voraussetzungen für neue tiefe, persönliche und erfüllende Freundschaften. Wenn Grenzen der Kultur, des Alters, der Herkunft und der sozialen Schichten fallen, dann müssten aus zugewucherten Trampelpfaden des Miteinanders doch recht schnell breite Autobahnen von Herz zu Herz entstehen.
Stattdessen wird aus der Hoffnung auf Freundschaft zu oft eine Erfahrung der Einsamkeit. Nicht selten verlassen Menschen die Gemeinde mit dem Urteil, dort von Heuchlern umgeben zu sein – oder bestenfalls von Menschen, die von einem hohen Anspruch der Liebe sprechen, aber den Einsamen nicht beachten. In der Gemeinde bleiben ein betretenes Schweigen und der Eindruck zurück, den Menschen nicht gerecht geworden zu sein. Kann es denn so schwer sein, in einer christlichen Gemeinde Freunde zu finden?
Mehr: www.evangelium21.net.
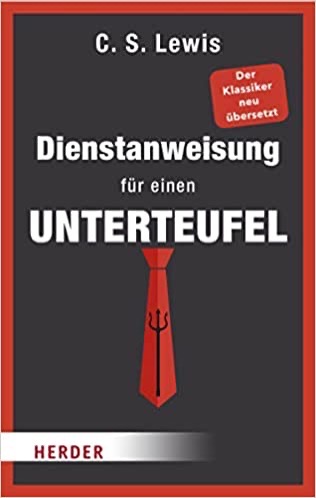 Millionen Leser weltweit haben schon gebannt C.S. Lewis fiktiven Briefwechsel Dienstanweisung für einen Unterteufel studiert. Verarbeitet werden dort Themen wie Alltagskonflikte, Verrat, Sex, Genusssucht und psychische Grausamkeiten. Joseph Kohm hat für Evangelium21 das Buch rezensiert und schreibt:
Millionen Leser weltweit haben schon gebannt C.S. Lewis fiktiven Briefwechsel Dienstanweisung für einen Unterteufel studiert. Verarbeitet werden dort Themen wie Alltagskonflikte, Verrat, Sex, Genusssucht und psychische Grausamkeiten. Joseph Kohm hat für Evangelium21 das Buch rezensiert und schreibt: