On ‚Sexual‘ Morality by C.S. Lewis
Haben Menschen ein uneingeschränktes Recht auf Glück? Hier die Animation eines Essays von C.S. Lewis:
VD: JO
Haben Menschen ein uneingeschränktes Recht auf Glück? Hier die Animation eines Essays von C.S. Lewis:
VD: JO
Michael Girke hat für die Literaturbeilage der Tageszeitung junge Welt (Ausgabe Nr. 233, 8. Oktober 2014) das neue Buch Gelegenheiten von Bettina Klix rezensiert. Hier einige Auszüge:
Vor einigen Monaten im Antiquariat meines Vertrauens stolperte mein Blick über einen ungewöhnlichen Titel. Der versprach etwas, ließ erwarten, dass in dem kleinen grünen Buch, welches er schmückte, ähnlich schöne Texte zu finden sein könnten, wie sie die passionierten Stadtwanderer Walter Benjamin und Franz Hessel einst zu Papier brachten. »Sehen Sprechen Gehen« hieß dieses Büchlein, das ich neugierig nach Hause trug – auch weil Bettina Klix, so der Name von dessen Autorin, mir als Filmkritikerin bekannt war. Ihr Buch stellte sich in der Tat als eine lose Sammlung von poetisierten Großstadtbegegnungen und -gesprächen heraus. Der Handlungsort wird nicht mit Klarnamen benannt, dürfte aber wohl jenes Berlin sein, in dem Bettina Klix geboren und das ihre Heimat ist. Walter Benjamin und Franz Hessel hatten die Straßen, Plätze und Fassaden dieser Stadt erkundet, Bettina Klix erkundet, was sich in und zwischen deren Menschen abspielt.
Nach »Sehen Sprechen Gehen« (immerhin schon 1993 erschienenen) keine Veröffentlichung mehr, Klix verschwand aus dem literarischen Leben. Über das Warum kann man nur spekulieren. Vielleicht hatte sie schlicht besseres zu tun, als zu schreiben; eine andere Möglichkeit wäre Misserfolg; noch eine die Schlangengrube Literaturbetrieb. Ganz aufgehört aber hat sie erfreulicherweise nicht. »Gelegenheiten« heißt Bettina Klix‘ neuer Band, und er enthält Erzählungen wie etwa jene über die Ungeschicklichkeit. Der Ungeschickte, heißt es darin, weigere sich auf seine Weise, Dinge so zu benutzen, wie es vorgeschrieben ist. »Das durch ihn erzeugte Unheil, mit dem die Dinge die Untauglichkeit des Ungeschickten darstellen, erlaubt es ihnen, sich endlich einmal zu zeigen.« Das trifft. Und zwar den Umstand, dass unser Alltagsblick dazu neigt, Vertrautes nicht mehr richtig wahrzunehmen. Dass aber ausgerechnet unsere Ungeschicklichkeit, die wir zumeist belächeln oder anders abtun, übersehenen Dingen wieder zu Beachtung verhelfen kann – dieser Gedanke dürfte den Wenigsten je gekommen sein. Woran man wieder merken kann, dass es gut ist, sich ab und an andere Augen einzupflanzen, sprich: zu guter Literatur zu greifen.
…
Begegnungen scheinen für Bettina Klix ganz besondere Bedeutung zu haben. In einer der Geschichten berichtet die Erzählerin von einem Gefühl der Unvollständigkeit, dass sie seit langem immer wieder heimsucht und an ihr nagt. Irgendwann sitzt ihr in der U-Bahn eine Frau gegenüber, welche eine Hand verloren hat und dies so gut es eben geht zu verbergen sucht. Aber nun gibt es ein Problem: Wie soll die Frau das Buch, in dem sie liest und dass sie in der verbliebenen Hand hält, unbemerkt umblättern? Die Begegnung reißt etwas auf, löst einen Erkenntnisschauder aus. Die Erzählerin weiß nun: Was sie sich zuvor über sich selbst eingeflüstert hatte (oder hat einflüstern lassen) und was wirklich existentielles Gewicht hat – das klafft beschämend weit auseinander.
Lauter solche flüchtigen »kleinen« Alltagsmomente hält Bettina Klix fest und verdichtet sie zu Handlungen und Epiphanien; mit viel Empfindungsvermögen und mittels einer von allem Effekthascherischen wohltuend freien Prosa.
Wirklich. Bettina Klix ist eine begnadete Beobachterin, eine Augenblicksammlerin eben. Reinschauen.
Auf der Familiensynode, die Papst Franziskus im Vatikan einberufen hat, geht es ziemlich heiß her. Die englische Übersetzung des Zwischenberichtes Relatio post disceptationem, die vor einigen Tage veröffentlich wurde, liegt inzwischen in einer revidierten Form vor. Es geht – wie kann es anders sein – um das Thema Homosexualität. Beide Übersetzungen der entsprechenden Abschnitte können hier eingesehen werden.
Es überrascht nicht, dass insbesondere die Vertreter der afrikanischen Kirche an der bisherigen Moraltheologie festhalten wollen. Der progressive Kardinal Walter Kasper aus Deutschland – von Papst Franziskus geschätzt – hat kurzerhand vorgeschlagen, die afrikanischen Bischöfe zu ignorieren.
African cardinals “should not tell us too much what we have to do,” Cardinal Kasper stated in an interview with ZENIT news agency, adding that he believes African participants in the synod are not being listened to.
The cardinal said African, Asian and Muslim countries are „very different, especially about gays
“You can’t speak about this with Africans and people of Muslim countries. It’s not possible. It’s a taboo,” he said. “For us, we say we ought not to discriminate, we don’t want to discriminate in certain respects.”
While Cardinal Kasper said African bishops are not being listened to at the synod, their views are “of course” listened to in Africa, “where it’s taboo.”
Das Interview ist inzwischen bei Zenit (jedenfalls von mir) nicht mehr zu finden. Deshalb hier weitere Auszüge: www.patheos.com.
In den letzten Tagen ging es durch die Presse: Facebook und Apple wollen ihren Mitarbeiterinnen in Amerika die Kosten für das Einfrieren von Eizellen erstatten – damit sie vor dem Kinderkriegen Karriere machen können.
Anna Reimann hat dieses tückische Angebot sehr persönlich und bewegend kommentiert:
Aber wenn das Angebot von Arbeitgebern kommt, geht das Ganze in eine gefährliche Richtung. Mich fröstelt es, wenn ich darüber nachdenke. Wer Kinderkriegen nicht nur rational betrachtet – wie es am besten in den Wirtschaftsplan des Arbeitgebers passt – der muss künftig als naiv, doof, altbacken und rückständig gelten. Und vor allem ist er dann selbst schuld, wenn es nicht klappt mit der eigenen Karriere.
Hier: www.spiegel.de.
 Das siebzehnte Heft des Magazins TIMOTHEUS ist erschienen; das Schwerpunkt ist „Die Auferstehung“.
Das siebzehnte Heft des Magazins TIMOTHEUS ist erschienen; das Schwerpunkt ist „Die Auferstehung“.
Hier die Beiträge:
Das Heft ist ab sofort über den Betanien-Shop erhältlich. Die verfügbaren Abos (Deutschland, Europa, Geschenk etc.) und bisher erschienen Ausgaben sind ebenfalls über die Timotheus-Seite des Shops erhältlich: www.cbuch.de/timotheus.
Ausgabe 18/2 (2014) des SBJT ist dem Leben und Werk von George Whitefield gewidmet. Folgende Beiträge sind enthalten:
Kinder sollen ihre „Lieblingsstellung“ zeigen, Puffs planen, Massagen üben. Die sexuelle Aufklärung missachtet Grenzen. Die Politik will es so. Unter dem Einfluss der „Gesellschaft für Sexualpädagogik“ sollen drei Lebensumstände entnaturalisiert werden: „die Kernfamilie, die Heterosexualität und die Generativität, also die Altersgrenzen zwischen den Generationen“. Kinderschützer schlagen Alarm.
Antje Schmelcher schreibt für die FAZ:
Ursula Enders vom Verein „Zartbitter“ gegen sexuellen Missbrauch von Mädchen und Jungen hält das für übergriffig. In der Arbeit der Fachberatungsstellen würden täglich das große Ausmaß der sexualisierten Gewalt durch Jugendliche und die durch die starke Pornographisierung der Gesellschaft ausgelöste Verwirrung vieler jugendlicher Mädchen und Jungen deutlich, sagt Enders.
Sexualpädagogik müsse Orientierung für einen Grenzen achtenden Umgang mit Sexualität vermitteln und zugleich einen geschützten Raum zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten bieten. „Eine Sexualpädagogik der Vielfalt“, die mit sexuell grenzverletzenden Methoden arbeitet, sei ein Etikettenschwindel. „Dies ist eine neue Form sexualisierter Gewalt, die zudem sexuelle Übergriffe durch Jugendliche fördert“, sagt Enders. In den achtziger Jahren hätten Pädosexuelle sexuellen Missbrauch und die Missachtung der Grenzen zwischen den Generationen als fortschrittliche Sexualpädagogik verkauft.
Heute würden von einigen Autoren und Sexualpädagogen berechtigte Anliegen der Transgenderbewegung benutzt, um älteren Kindern und Jugendlichen eine Auseinandersetzung mit Formen der Sexualität aufzudrücken, die persönliche Grenzen verletzen, so Enders. Es entspreche keineswegs den Fragen von 14 Jahre alten Mädchen und Jungen, wenn sie zum Beispiel für eine Gruppenübung Sexartikel wie einen Dildo, Potenzmittel, Handschellen, Aktfotos und Lederkleidung erwerben sollen. Enders fragt: „Wie mag eine Jugendliche, die im Rahmen von Kinderprostitution verkauft wird, sich wohl fühlen, wenn sie im Sexualkundeunterricht einen ,neuen Puff für alle‘ planen soll?“
„Das ist brandgefährlich“, sagt auch die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Christina Hennen von der Vereinigung Deutscher Psychotherapeuten. Eine solche Sexualpädagogik sei der Versuch, die Schamgrenzen von Kindern und Jugendlichen aufzubrechen. Pädagogen, die die Abhängigkeit der Schüler ausnutzen, könnten so Gehorsam erzwingen, glaubt Hennen.
Unbedingt lesen: www.faz.net.
Die Stadt Houston (USA) hat eine Gruppe von Pastoren aufgefordert, alle Predigten, die Homosexualität, Gender Identität oder die lesbische Bürgermeisterin Anise Parker thematisieren, auszuhändigen. Wenn ein Pastor dieser Aufforderung nicht nachkommt, droht ihm die Vorladung vor Gericht.
Mehr: www.foxnews.com.
Johannes S. hat mich freundlicherweise auf einen beachtenswerten Vortrag hingewiesen, den Gabor Steingart, heute zur Geschäftsführung der Verlagsgruppe Handelsblatt gehörend, im November 2013 in München gehalten hat. Steingart sprach über die Krise des Journalismus. Seine Analyse unterscheidet sich von dem, was dazu sonst in den Feuilletons zu lesen ist. Die journalistische Attraktivität schrumpft seiner Meinungen nach nicht wegen der „Googlelisierung“ oder Globalisierung, sondern ist hausgemacht.
Er nennt folgende sieben Gründe:
1. Der Journalismus ist eintönig geworden. „Die Methoden der publizistischen Telepathie – einer erfühlt, was der andere nicht denkt – erzeugen jenes Einheitsmaß der Inhalte, das selbst dem flüchtigen Leser wie eine innere Gleichschaltung erscheinen muss. Die Frontseite einer beliebigen Zeitung erscheint als das Derivat einer anderen, notdürftig getarnt durch unterschiedliche Schrifttypen und Bildgrößen. Wenn wir die deutsche Pressekultur unserer Tage in den Kategorien der Landwirtschaft zu erfassen hätten, müssten wir von Monokultur sprechen“ (S. 2).
2. Der Journalismus betreibt zuweilen Desinformation durch Information. „Aber was wir uns vorwerfen müssen, ist die Tatsache, dass alle immer den gleichen Fehler sehen und offenbar nur im Kollektiv Recht haben können. Das Meutehafte des Auftretens und die Wiederholung des bereits Wiederholten wirkt wirklichkeitsverändernd. Nicht selten werden die Überbringer der Botschaft zu ihrem Erzeuger. Plötzlich sieht das Feriendomizil des Carsten Maschmeyer aus wie das Watergate-Hotel in Washington. Und weil gerade kein Bösewicht vom Schlage eines Richard Nixon zur Stelle ist, muss Präsidentendarsteller Christian Wulff zurücktreten. Die Mücke hat als Elefant ihren Auftritt“ (S. 3).
3. Die Journalisten haben sich mit der Politik eins gemacht. „Nicht wenige politische Redakteure pilgern zu den Flachbauten der Parteipolitik als handele es sich um Kathedralen. Man sieht sich in einer Bedeutungskoalition mit den Parteigrößen. Deren Niedergang wird als der eigene erlebt – und deshalb weich gezeichnet. Es kam zu einer Synchronisierung der Interessen“ (S. 3).
4. Der Journalismus ist nicht ausreichend transparent. „Der Herstellungsprozess von Fischstäbchen und Gummibärchen ist – dank strenger Lebensmittelgesetze – mittlerweile deutlich durchsichtiger als die Entstehung journalistischer Produkte. Von jeder Garnele kennen wir Eiweißgehalt, Aufzuchtbedingungen und Haltbarkeit. Von der Ware Information oft nicht mal den Herkunftsort“ (S. 5).
5. Der Journalismus scheut den Austausch mit den Meinungen der Leser. „Der oft ideenreiche und nicht selten sprachgewitzte Leser fristet – wie im ersten Jahr des Zeitungsdrucks – sein Dasein im Gefängnis der Leserbriefspal-ten. Die Regierung kann man abwählen, in den Betrieben regieren die Betriebsräte mit, in den Familien wurde der patriarchalische Status des ‚Familienoberhaupts‘ hinweggefegt, nur in den Presseorganen herrscht der reinste Feudalismus. ‚Hier endet die Demokratie‘ – diesen Satz hatte Karl Marx in seiner Zeit als Chefredakteur der Rheinischen Zeitung an seine Tür geheftet. Dort hängt er noch immer“ (S. 5–6).
6. Die Wirtschafts-Berichterstattung ist oft nicht auf der Höhe der Probleme. „Die Staatsschuldenkrise – die die gesamte westliche Welt erfasst hat – wird hierzulande auf eine Euro-Krise oder gar auf eine Griechenlandkrise verkürzt. Damit werden die Vorgänge ihrer eigentlichen Urheber entledigt. Die Staaten waren es, zwar jeder in seiner Währung, Dollar, Yen, Pfund und Euro, die Zahlungsverpflichtungen eingegangen sind, die sie heute nur mit Mühe bedienen können. Wohlstand wurde in hohen Dosen an den Finanzmärkten dazugekauft“ (S. 6).
7. Der Journalismus hat sich unterwerfen lassen. „Ein entkräfteter Journalismus hat vielerorts zugelassen, dass die Kaste der Kaufleute das Kommando übernahm. Es kam zu einer Verschiebung in der inneren Machtarchitektur der Verlage. Seither begegnet uns der Bock in der Schürze des Gärtners“ (S. 6–7).
Ein äußerst lesenswerter Vortrag, der hoffentlich zur Qualitätssteigerung im Journalismus beiträgt.
Bettina Hahne-Waldscheck schreibt in der empfehlenswerten Zeitschrift factum (Ausgabe 7/2014, S. 49) über das Buch:
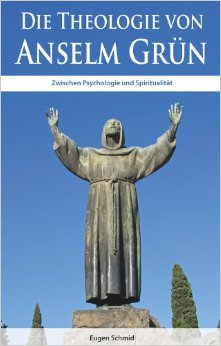 Grün, so schreibt der Autor, «psychologisiert die christliche Botschaft». Laut Grün sind wir zusammengesetzt aus Gegensätzen, die wir annehmen müssten. So würden wir dann «eins werden mit dem ganzen Kosmos». Eugen Schmid zeigt brillant auf, dass im Zentrum von Grüns Lehre die Innenschau (Esoterik) und der Mensch stehen. Indem Grün Gott im Innern zentriert, überhöht er die menschliche Natur. Nicht die Entfremdung von Gott sei die Schuld des Menschen, sondern die Entfremdung von sich selbst. So wird Jesu Tat am Kreuz bei Grün auf eine innerweltliche Ebene der Vergebung reduziert. Er spricht nicht von Jesus als Erlöser, sondern von einem, der uns innen erleuchten soll. Damit verkündet er einen anderen «Christus», der mit dem Jesus Christus, von dem die Bibel erzählt, nicht mehr viel zu tun hat. Schmids Buch ist übersichtlich gegliedert in Themen wie unter anderem «Die Frage des Bösen», «Liebe», «Himmel», «Demut», «Vergebung», «Erlösung». Mit vielen Zitaten Grüns untermauert der Autor seine Thesen und zeigt die Wurzeln von Grüns Denken, besonders mit Blick auf die Tiefenpsychologie, auf.
Grün, so schreibt der Autor, «psychologisiert die christliche Botschaft». Laut Grün sind wir zusammengesetzt aus Gegensätzen, die wir annehmen müssten. So würden wir dann «eins werden mit dem ganzen Kosmos». Eugen Schmid zeigt brillant auf, dass im Zentrum von Grüns Lehre die Innenschau (Esoterik) und der Mensch stehen. Indem Grün Gott im Innern zentriert, überhöht er die menschliche Natur. Nicht die Entfremdung von Gott sei die Schuld des Menschen, sondern die Entfremdung von sich selbst. So wird Jesu Tat am Kreuz bei Grün auf eine innerweltliche Ebene der Vergebung reduziert. Er spricht nicht von Jesus als Erlöser, sondern von einem, der uns innen erleuchten soll. Damit verkündet er einen anderen «Christus», der mit dem Jesus Christus, von dem die Bibel erzählt, nicht mehr viel zu tun hat. Schmids Buch ist übersichtlich gegliedert in Themen wie unter anderem «Die Frage des Bösen», «Liebe», «Himmel», «Demut», «Vergebung», «Erlösung». Mit vielen Zitaten Grüns untermauert der Autor seine Thesen und zeigt die Wurzeln von Grüns Denken, besonders mit Blick auf die Tiefenpsychologie, auf.