Freud – jenseits des Glaubens
Soweit ich weiß, sind sich Sigmund Freud (1856–1939) und C.S. Lewis (1898–1963) nie persönlich begegnet. Was aber wäre passiert, wenn sie miteinander über den Glauben diskutiert hätten? Der Film „Freud – jenseits des Glaubens“ sucht genau darauf eine Antwort. Dietmar Dath schreibt in seiner Filmbesprechung:
Die professionelle Umgebung macht Hopkins sichtlich gute Laune: „I spent most of my life examining fantasies“, raunzt sein Freud, jetzt werde es Zeit „to make sense of . . . reality“, was immer das sei, die Wirklichkeit. Lewis kennt sie auch nicht, er gehört schließlich zu einer besonders realitätsresistenten Autorengruppe, den Inklings, genau wie Tolkien, der einen kurzen Gastauftritt hat. Hopkins hätte ihm gefallen, denn der genießt mit exquisit moribunder Betonung das Wörtchen „spooky“, als hätte er es soeben erfunden.
Die Redeschlacht zwischen Lewis und Freud leidet etwas darunter, dass die einschlägigen Positionen der historischen Vorbilder durch allgemeinmenschliche Motivationen ersetzt sind (Verbitterung, Hoffnung und so weiter). Als Lewis behauptet, per biblischem Quellenstudium zu seinem Bekenntnis gefunden zu haben, erwidert Freud keineswegs mit dem für ihn naheliegenden Verdacht, es könne sich um das handeln, was er „Rationalisierung“ getauft hat. Umgekehrt fällt Lewis, als Freud obstinat die bittere Impraktikabilität des Nächstenliebegebotes anprangert, verblüffenderweise die soteriologisch korrekte Antwort nicht recht ein: Eben weil niemand so selbstlos und gut ist wie der barmherzige Samariter, brauchen wir Christi Sühnopfer und können uns nicht durch Werke selbst erlösen.
Hier mehr und ein Trailer:
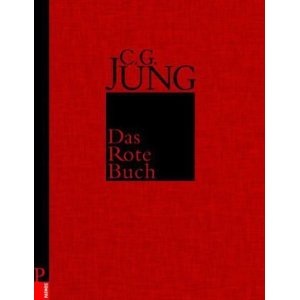 Als geheimnisvolles
Als geheimnisvolles 