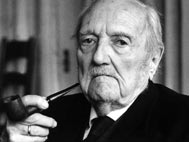 Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?
Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?
Auf der einen Seite wurde er mit dem Reduktionsverfahren der liberalen Theologie konfrontiert. Die Exegeten und Ethiker des 19. Jahrhunderts hatten die Botschaft des Neuen Testaments auf bestimmte religiöse und sittliche Grundgedanken reduziert. Bultmann sah darin einen offensichtlichen Mangel des göttlichen Bezugs in der Rede von Gott. Da es hierbei um Religiosität aber nicht um Heil ging, lehnte er diesen Weg mit aller Schärfe ab. Auf der anderen Seite fehlte jedoch dem bekenntnisorientierten Biblizismus der Bezug zur Geschichte. Von dem modernen Menschen könne man nicht mehr erwarten, dass er die Mythologie des Neuen Testaments bejahe. Bultmann: „Kann die christliche Verkündigung dem Menschen heute zumuten, das mythische Weltbild als wahr anzuerkennen?“ Die Antwort ist klar: „Das ist sinnlos und unmöglich.“
Obwohl Bultmann sich seit Jahren mit dem Problem beschäftigte und darüber publizierte, war es ein 1941 gehaltener Vortrag zu dem Thema: „Neues Testament und Mythologie“, der Bultmann berühmt machte. Der Beitrag wurde noch im selben Jahr als kleines Buch gedruckt und nach dem Krieg in großen Mengen verkauft. Bultmann hat darin – so kann man es sehen – sein Lebenswerk zusammengefasst. Hier zeichnet er den gesuchten dritten Weg, der seiner Meinung nach sowohl der Geschichte als auch Gott angemessen ist.
Bultmann möchte das Wort der Bibel wieder so verständlich machen, dass es die aufgeklärten Menschen der Neuzeit als Anrede Gottes verstehen können. Was das Wesen des Wortes der Bibel verdunkelt, ist der tiefe Graben zwischen der mythologischen Vorstellungswelt damals und der aufgeklärten heute. Unser Weltbild wird durch die Wissenschaft bestimmt, das Weltbild des Neuen Testaments dagegen ist durch und durch mythologisch. Das Neue Testament stellt uns einen dreistöckigen Kosmos vor, in dem jeweils Gott, Satan und Mensch zu Hause sind. Für uns ist das nicht mehr akzeptabel. Es ist, so formuliert Bultmann gern, „erledigt“. Erledigt sind die Geschichten von der Höllen- und Himmelfahrt Christi. Erledigt ist die Vorstellung von einer unter kosmischen Katastrophen hereinbrechenden Endzeit. Erledigt ist die Erwartung des auf den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes. Erledigt sind die Wunder als bloße Wunder. Erledigt ist der Geister- und Dämonenglaube.
Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muß sich klar machen, daß er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.
Aber nicht nur das naturwissenschaftliche Weltbild fordert Bultmann zur Kritik an den mythologischen Vorstellungen der Bibel heraus. Noch wichtiger ist ihm das Selbstverständnis des modernen Menschen.
Der Mensch versteht sich nicht mehr als ein dualistisches Wesen, das für das Eingreifen Gottes offen und bereit ist. Der Mensch von heute ist ein geschlossenes Wesen, dass sich selbst sein Denken, Fühlen und Wollen zuschreibt. Wieder fährt Bultmann scharfe Geschütze auf: Unverständlich ist für den modernen Menschen die Vorstellung von dem göttlichen Geist als einem übernatürlichen Etwas, das in das Gefüge der natürlichen Kräfte eindringt. Unverständlich ist für ihn die Deutung des Todes als einer Strafe für die Sünde. Unverständlich ist für ihn die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung durch das Sterben Christi am Kreuz. „Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff?“ Unverständlich ist die Auferstehung Christi als ein Ereignis, durch das eine Lebensmacht entbunden ist, die man sich durch Sakramente aneignen kann. Unverständlich ist für ihn die Erwartung, in die himmlische Lichtwelt versetzt und dort mit einem neuen, geistlichen Leib überkleidet zu werden.
Wie nun ist dieser große Widerspruch zwischen der mythologischen Welt der Bibel und dem Weltbild und Selbstverständnis des modernen Menschen aufzulösen? Den Weg des Liberalismus kann Bultmann nicht gehen. Der Weg des Biblizismus ist für ihn ein Gräuel. Seine Antwort lautet: Soll die Verkündigung des Neues Testamentes ihre Gültigkeit behalten, so gibt es gar keinen anderen Weg als sie zu entmythologisieren.
So macht sich es Bultmann zum Programm, das Heilsgeschehen, über das im Neuen Testament berichtet wird, ohne Mythos darzustellen und damit die Wahrheit der biblischen Botschaft so zu vermitteln, dass sie glaubhaft wird. Bultmann will nicht im Sinne des Liberalismus den Mythos eliminieren. Nein. Im Mythos wird der Mensch inne, dass die Welt, in der er lebt, voller Rätsel und Geheimnisse ist, dass er nicht Herr über die Welt und sein Leben ist, sondern vielmehr abhängig von Mächten jenseits des Bekannten. Der Mythos erzählt über die Unkontrollierbarkeit des Lebens jedoch in einer unzureichenden Art und Weise. Er redet vom Unweltlichen weltlich. Er objektiviert das Jenseits zum Diesseits. Die Götter erscheinen als menschliche Wesen. Der Mythos steht sich in der modernen Gesellschaft selbst im Wege. Und so fordert Bultmann in seinem Verfahren nicht die Eliminierung des Mythos, sondern seine existenziale Interpretation. Er will die mythologischen Vorstellungen nicht ausschalten, sondern auf ihr Existenzverständnis befragen. Der tiefere Sinn, die nicht offensichtliche Bedeutung der Texte, soll aufgedeckt und verkündet werden.
Entmythologisierung ist für Bultmann also nicht eine Verkürzung der Botschaft, sondern seine hermeneutische Methode zum Aufschließen der eigentlichen Botschaft der Bibel. Bultmann wörtlich: „Ich nenne eine solche Interpretation existenziale Interpretation, da sie bewegt von der Existenzfrage des Interpreten, nach dem in der Geschichte jeweils wirksamen Existenzverständnis fragt“ (Rudolf Bultmann, „Zum Problem der Entmythologisierung“, in: Hans Werner Bartsch, Herbert Braun u. a., Kerygma und Mythos VI, Hamburg, 1963, S. 20–27, hier S. 21).
Spätestens jetzt, bei der Hermeneutik, können wir seine Nähe zu Heidegger feststellen. Heidegger hatte in seinem Hauptwerk Sein und Zeit versucht, das traditionelle Subjekt-Objekt-Denken, dass die Philosophie von der Antike her bis in die Neuzeit beherrschte, zu überwinden. Er machte das falsche Geschichtsbild dieses Denkschemas für das Scheitern der Philosophie verantwortlich. Das Kennzeichen des Historismus besteht nach Heidegger darin, dass die Werke der Geschichte als Quellen benutzt werden, aus denen man ein Bild der Vergangenheit rekonstruiert. Der Historiker protokolliert und sortiert die Geschichte und produziert damit ein statisches Abbild des einmal Gewesenen. Nach Heidegger ist das ignorant. Die Welt wird zum Gegenstand, den der Mensch zu begreifen sucht. Und damit springt der Mensch geradezu aus seiner Existenz heraus. Er malt sich ein Bild von der Welt ohne die Berücksichtigung der eigenen Existenz.
Genau das sucht Heidegger zu überwinden. Er denkt in seiner Philosophie nicht im klassischen Subjekt-Objekt-Schema, sondern in der Kategorie des Seins. Der Mensch lässt sich von der Geschichte ergreifen, als ein Teil von ihr mit hineinziehen. Verstehen der Geschichte vollzieht sich in der Begegnung mit der Geschichte (der Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer sprach von „Horizontverschmelzung“). Diese Begegnung stellt unsere eigene Existenz in Frage, deckt die Geschichtlichkeit des eigenen Daseins auf. Indem der Mensch in den Dialog mit der Geschichte eintritt, tritt er in ein Gespräch mit sich selbst ein. Geschichtsauslegung und Selbstauslegung korrespondieren miteinander.
So geht es auch Bultmann nicht um das Konstatieren historischer Ereignisse, sondern um das, was in der Mythologie das eigentlich Bedeutsame für unsere Existenz ist. Seine Antwort lautet „Kerygma“. Der Begriff Kerygma stammt aus dem Neuen Tetstament und bedeutet so viel wie „Botschaft“, „Proklamation“, „Predigt“. Der Inhalt des Kerygmas ist das Christuszeugnis. Wo das Christusgeschehen gegenwärtig ist, da können Menschen heil werden.
Bultmann wiederholt immer wieder, dass uns Christus im Wort begegnet, und zwar nur im Wort. Ich zitiere: „Im gepredigten Wort und nur in ihm begegnet der Auferstandene.“ Oder: „Jesus Christus begegnet dem Menschen nirgends anders als im Kerygma“. Noch ein klassischer Bultmann-Satz: „Indem Gott Jesus kreuzigen ließ, hat er für uns das Kreuz errichtet: an das Kreuz Christi glauben, heißt nicht, auf einen mythischen Vorgang blicken, der sich außerhalb unser und unserer Welt vollzogen hat, auf ein objektiv anschaubares Ereignis, das Gott als uns zugute geschehen anrechnet; sondern an das Kreuz glauben, heißt, das Kreuz Christi als das eigene übernehmen, heißt, sich mit Christus kreuzigen lassen.“
Kerygma als die Christusbotschaft im Wort korrespondiert bei Bultmann mit dem Selbstverständnis. Das Offenbarungshandeln Gottes, dass uns im Kerygma begegnet, verleiht uns ein neues Selbstverständnis. Es lehrt uns, uns in einem neuen Licht zu sehen. Der Glaube ruft in eine neue Existenz.
Bultmanns Programm der Entmythologisierung wirkt rückblickend ziemlich autoritär. Er weiß ganz genau, was „modern“ und damit annehmbar ist und was nicht. Die Weltanschauung, die er instrumentalisiert um die Offenbarung zu kritisieren, ist heute – nur 60 Jahre später – selbst ein Mythos.
Ein anderer Kritikpunkt wirkt noch schwerer: Da man von Gott nur indirekt reden kann, sind alle theologischen Aussagen nur als existentielle Aussagen wahr. Alle Mitteilungen über Gott müssen in die menschliche Existenz gefasst sein. Darum kommt Bultmann zu einem wichtigen Satz. Wer diesen Satz verstanden hat, hat wahrscheinlich Bultmann verstanden: „Will man von Gott reden, so muß man offenbar von sich selbst reden.“ Die Rede von Gott wird zur Rede über den Menschen. Das Unendliche ist letztlich das Eigentliche des Endlichen, Theologie ist Anthropologie.
Es war Bultmanns Anliegen, die Spannung zwischen Geschichte und Offenbarung zu überwinden. Er entschied sich gegen die Geschichte für die Offenbarung, redet jedoch nur vom Menschen.
Der Theologieprofessor Matthias Krieger wirbt in dem nachfolgenden DLF-Gespräch für das Programm der Entmythologisierung. Er spricht so, als ob wir von Bultmann noch viel erwarten könnten. Ich rechne eher damit, dass nach 100 Jahren Metaphysik- und Mythoskritik die Freude am Metaphysischem zurückkehrt. Kein Wunder. So viel Anthropozentrismus muss irgendwann langweilig werden.
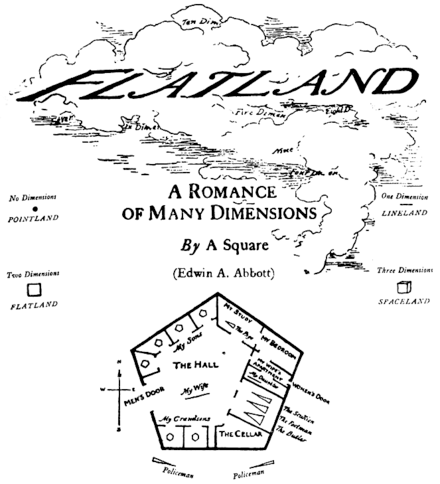
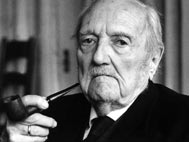 Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?
Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?