Nachfolgend eine Rezension von Angus Menuge zum Buch:.
- J. P. Moreland, Chad Meister u. Khaldoun A. Sweis (Hrsg.): Debating Christian Theism, New York: Oxford University Press, 2013, 576 S. ca. 35,- Euro.
 Was wäre der aufschlussreichste Test, um herauszufinden, ob das historische Christentum auf dem Marktplatz der Ideen immer noch eine ernstzunehmende Alternative darstellt? Wie wäre es mit einer sorgfältig geplanten Reihe von Diskussionen über alle zentralen Lehren des Christentums (was C. S. Lewis „Bloßes Christentum“ genannt hat), wobei die besten Vertreter aller Richtungen mitdiskutieren – sowohl theologisch Konservative und Liberale, die wichtigsten christlichen Apologeten als auch die stärksten skeptischen Gegner? [Anm. der Red.: Mere Christianity ist der Buchtitel eines von C. S. Lewis veröffentlichten Bestsellers, der auf Radioansprachen zwischen 1942 und 1944 zurückgeht und Kernaspekte des Christentums (wie sie von traditionellen christlichen Denominationen geteilt werden) gegen Kritiker verteidigt. In deutscher Sprache ist der Klassiker zunächst erschienen unter dem Titel Christentum schlechthin, heute ist es unter dem Titel Pardon, ich bin Christ. Meine Argumente für den Glauben erhältlich.] Das wäre der Idealfall, allerdings erscheint das Ziel hochgegriffen: persönliche Vorbehalte oder politisch-ideologische Vorgaben könnten es schwierig machen, beide Seiten zur Teilnahme zu motivieren. Und es steht viel auf dem Spiel, denn die Ideen, die in bestimmten akademischen Kreisen als offensichtlich wahr erscheinen, könnten in einem anderen akademischen Umfeld schlichtweg als widerlegt gelten. Weder die Verteidiger noch die Kritiker des Kernbestands des Christentums können diese Debatte völlig sorglos angehen. Beide benötigen eine ordentliche Portion Mut.
Was wäre der aufschlussreichste Test, um herauszufinden, ob das historische Christentum auf dem Marktplatz der Ideen immer noch eine ernstzunehmende Alternative darstellt? Wie wäre es mit einer sorgfältig geplanten Reihe von Diskussionen über alle zentralen Lehren des Christentums (was C. S. Lewis „Bloßes Christentum“ genannt hat), wobei die besten Vertreter aller Richtungen mitdiskutieren – sowohl theologisch Konservative und Liberale, die wichtigsten christlichen Apologeten als auch die stärksten skeptischen Gegner? [Anm. der Red.: Mere Christianity ist der Buchtitel eines von C. S. Lewis veröffentlichten Bestsellers, der auf Radioansprachen zwischen 1942 und 1944 zurückgeht und Kernaspekte des Christentums (wie sie von traditionellen christlichen Denominationen geteilt werden) gegen Kritiker verteidigt. In deutscher Sprache ist der Klassiker zunächst erschienen unter dem Titel Christentum schlechthin, heute ist es unter dem Titel Pardon, ich bin Christ. Meine Argumente für den Glauben erhältlich.] Das wäre der Idealfall, allerdings erscheint das Ziel hochgegriffen: persönliche Vorbehalte oder politisch-ideologische Vorgaben könnten es schwierig machen, beide Seiten zur Teilnahme zu motivieren. Und es steht viel auf dem Spiel, denn die Ideen, die in bestimmten akademischen Kreisen als offensichtlich wahr erscheinen, könnten in einem anderen akademischen Umfeld schlichtweg als widerlegt gelten. Weder die Verteidiger noch die Kritiker des Kernbestands des Christentums können diese Debatte völlig sorglos angehen. Beide benötigen eine ordentliche Portion Mut.
Das Buch Debating Christian Theism ist ein wegweisendes Werk, da es bisher diesem Ideal mehr als jedes andere nahekommt. Es ist ein grundlegender und wesentlicher Beitrag zu einem authentischen Dialog ohne Sprechverbote, vergleichbar etwa mit dem Werk Debating Design: From Darwin to DNA (New York: Cambridge University Press, 2004) von William Dembski und Michael Ruse.
Es besteht aus zwanzig Dialogen (daher vierzig kurze Kapitel), die die klassische natürliche Theologie (die Argumente für Gottes Existenz), die Kohärenz des Theismus, das Problem des Bösen, den evolutionären Ansatz zur Erklärung der Entstehung religiösen Glaubens, die menschliche Natur, die Wunder, Wissenschaft und Glauben, die Dreieinigkeit, die Versöhnung, die Inkarnation, die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift, den historischen Jesus, die Auferstehung, die Inklusivismus-/Exklusivismus-Debatte bezüglich des Heils, sowie Himmel und Hölle, abdecken.
Zunächst einige allgemeine Anmerkungen zu dem Buch. Es fällt auf, dass sich die Verteidiger des historischen Christentums mit dem Denken ihrer Kritiker meist gründlicher auseinandergesetzt haben, als die Kritiker des Christentums mit den Werken der Christen. Außerdem greifen die Verteidiger des Christentums in ihren Argumenten seltener auf ad hoc-Manöver zurück. Auch wenn das Buch recht lang ist (über 500 Seiten), ist es ein Gewinn, dass jeder Austausch kurz und bündig gehalten ist und sich auf die wirklich essentiellen Fragen des jeweiligen Gebiets konzentriert. Das erlaubt dem Laien oder jemandem, der sich eher auf andere Bereiche spezialisiert hat, den schnellen Zugang zu einer großen Zahl bedeutsamer Debatten.
Andererseits – und das erscheint mir bei der Komplexität des Projekts unvermeidlich – sind nicht alle Diskussionen gleichermaßen ergiebig. In einigen Fällen hat man den Eindruck, dass ein Wissenschaftler nicht den besten Sparringspartner erhalten hat. Und bei nur zwei Teilnehmern je Thema könnten einige Leser sich manchmal darüber ärgern, dass keiner der beiden das repräsentiert, was sie selbst glauben. Aber die offensichtlichen Alternativen wären entweder zu oberflächlich (alle Sichtweisen werden dargestellt, aber dann viel kürzer und nur skizzenhaft), oder untragbar lang (alle Sichtweisen werden sehr gründlich dargestellt). Es erscheint weise, dass die Autoren offenbar lieber so viele Themen wie möglich untersuchen wollten, als so viele Meinungen wie möglich darzustellen. Schauen wir uns also einige der Diskussionen näher an. (Aus Platzgründen können unmöglich alle behandelt werden.)
William Lane Craig verteidigt das Kalām-kosmologische Argument für die Existenz Gottes, indem er philosophische und wissenschaftliche Gründe für folgende Behauptungen anführt: das Universum fing an zu existieren; dieser Anfang war von etwas anderem verursacht; diese Ursache ist personaler Natur. In seiner Kritik behauptet Wes Morriston, dass die Kosmologie nicht hinreichend fortgeschritten ist, um zuversichtlich Schlüsse über den Anfang der Zeit ziehen zu können, (bzw. „um in der Zeit rückwärts bis zum ‚Zeitpunkt null‘ zu extrapolieren“), und selbst das gäbe uns „keinen Grund zu schließen, dass auf der anderen Seite des Anfangs nichts war“ (S. 21).
Nun spricht aber die Tatsache, dass wir den „Zeitpunkt null“ nicht genau kennen, in keiner Weise gegen die überwältigenden Indizien, dass es so eine Zeit gab, und natürlich denken Theisten, dass Gott, und nicht etwa das Nichts, auf der anderen Seite des „Zeitpunkts null“ war. Morriston stimmt dem philosophischen Argument von Craig zu, dass wir – wenn die Vergangenheit ewig wäre – nicht verstehen könnten, warum jemand, der seit Ewigkeiten zählt (von einem negativen Unendlichen bis null), gerade heute bei der Null ankommt und nicht gestern; aber er behauptet, es könnte dennoch so gewesen sein. Aber das Problem ist doch gewiss dieses, dass für alle endlichen k gilt, dass sowohl ein Unendlich minus k als auch ein Unendlich plus k in gleicher Weise unendlich sind. Daher gilt: wenn diese Person aufhört zu zählen, könnten wir erwarten, dass er immer und immer wieder „aufhört“ zu zählen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das ist aber inkohärent. „Bei null aufhören zu zählen“ sollte eigentlich nur einmal geschehen, und zu behaupten, dass jemand immer wieder aufhört zu zählen, ist dasselbe, wie zu sagen, dass er überhaupt nicht zu zählen aufhört. Das mag in Filmen wie Inception oder Ground Hog Day (dt. Und täglich grüßt das Murmeltier) Sinn machen, aber im Alltag wäre dies sicher absurd, und das war es ja, worauf Craig hinauswollte.
Morriston bezweifelt auch, dass man das plötzliche Erscheinen eines wütenden Tigers im Raum (welcher eine Ursache benötigt) analog zum ersten In-die-Existenz-Kommen des Universums sehen kann. [Anm. der Red.: W. L. Craig sagt, ein Entstehen des Universums aus dem Nichts (ohne jede Ursache) ist sehr unwahrscheinlich und kontraintuitiv. Denn sonst müssten wir in unserer Alltagserfahrung häufiger die Erfahrung machen, dass plötzlich Dinge aus dem Nichts entstehen, so z. B. der erwähnte „wütende Tiger“.] Denn in unserer Erfahrung werde „nie etwas innerhalb der Zeit von etwas anderem verursacht, das nicht selbst innerhalb der Zeit liegt“ (S. 30). Allerdings ist das grundlegende Konzept von Verursachung ja die Hervorbringung, die nicht zwingend eine zeitliche Abfolge darstellen muss, und der Vertreter des Kalām-Arguments kann gewiss auf das Leibniz’sche Prinzip des zureichenden Grundes verweisen, um zu argumentieren, dass das Universum – anders als Gott – keinen hinreichenden Grund für seine Existenz in sich selbst hat. Nichts Physisches kann da als Ersatz für Gott herhalten, denn physischer Natur zu sein, heißt, zeitlich und räumlich gebunden zu sein, und es ist nicht notwendig, dass Raum und Zeit überhaupt existieren (eine Welt von zeitlosen abstrakten Objekten ist sicherlich eine mögliche Welt). Der Verteidiger des Kalām-Arguments könnte z. B. E. J. Lowes ontologisches Argument anführen (siehe unten), weil es einfach auf der Vorstellung einer metaphysischen Abhängigkeit kontingenter Wesen von einem notwendigen konkreten Wesen basiert, und diese Abhängigkeit hat nichts mit der Zeit zu tun.
Ein Beispiel, wo die Gesprächspartner nicht wirklich miteinander diskutieren, ist der Austausch zwischen Robin Collins und dem kürzlich verstorbenen Victor Stenger. Collins trägt Argumente für die Feinabstimmung der Naturgesetze, der Anfangsbedingungen des Universums sowie der fundamentalen Naturkonstanten, welche notwendig sind, damit körperliche Wesen mit Bewusstsein (kWB) entstehen können, vor. Stenger versucht, diesem Projekt einen Dämpfer zu versetzen, indem er versichert, dass die Werte der physikalischen Parameter und Konstanten willkürlich sind, denn die „Maßeinheiten wurden nach Belieben gewählt und haben keine Bedeutung an sich“ (S. 50). Er sagt zudem wiederholt, dass es keine Feinabstimmung gibt, denn die verschiedenen Korrelationen sind „fixiert durch die etablierte Physik und Kosmologie“ (S. 50–52) und fallen „in die Bandbreite, die man von … Metagesetzen erwarten kann“ (S. 49). Aber die Willkür bei der Wahl der Maßeinheiten berechtigt ja nicht zum Schluss, dass auch die empirisch entdeckten Beziehungen zwischen den Parametern willkürlich sind, und die Berufung auf „Metagesetze“ und „etablierte Physik und Kosmologie“ verschiebt nur die Frage: Warum sind sie derart, dass sie kWB ermöglichen, angesichts der großen Anzahl von Alternativen, bei denen kWB nicht entstehen oder überleben könnten?
Ein Beispiel für eine ad hoc-Verteidigung des Naturalismus liefert der Austausch zwischen dem kürzlich verstorbenen E. J. Lowe und Graham Oppy. Lowe schlägt eine durchdachte (ausgeklügelte) Version des ontologischen Argumentes vor, welches auf der Idee der metaphysischen Abhängigkeit gründet, und Oppy (der eigentlich eine frühere Version des Argumentes kritisiert) behauptet, dass ein solches Argument nicht zeigen kann, dass der Naturalismus logisch inkonsistent ist (S. 73) und dass der Naturalist einfach behaupten kann, dass es ein „absolut unabhängiges natürliches Wesen gibt“ (S. 76). Aber der Naturalismus wird ja gewiss noch nicht dadurch plausibel, dass er logisch möglich ist, und wenn Oppy versucht darzulegen, wie dieses unabhängige natürliche Wesen beschaffen sein könnte, klingt die im Resultat vertretene Sichtweise verdächtig wenig nach Naturalismus. Oppy versichert, dass es ewige und einfache und dennoch natürliche Einheiten geben könnte, und „wenn die natürliche Realität einen Ursprung hat, könnte dieser Ursprung – also der Anfangszustand der Realität – einfach notwendigerweise existieren, keine Teile haben, und für seine Identität nicht auf etwas anderem basieren“ (S. 79). Nun, was macht diese „einfachen Einheiten“ natürlich? Entweder, „natürlich“ heißt raumzeitlich gebunden, oder nicht. Wenn ja, dann gibt es keinen Grund anzunehmen, dass sie existieren müssen, denn Raum und Zeit müssen nicht existieren. Also ist die Vorstellung von notwendigen raumzeitlichen Objekten inkohärent. Aber wenn „natürlich“ nicht raumzeitlich gebunden heißt, dann riskiert Oppy, dass seine Ablehnung des Theismus rein verbal bedingt ist (bzw. auf Etikettenschwindel basiert), denn dann nennt er ein Wesen „natürlich“, welches göttliche Eigenschaften wie Zeitlosigkeit und Selbstgenügsamkeit hat.
Die Diskussion zwischen Paul Copan und Louise Antony illustriert die Tatsache trefflich, dass die besten christlichen Philosophen ihre Kritiker besser kennen, als andersherum. Copan vertritt sehr schlüssig, dass der Naturalismus keinen Sinnzusammenhang dafür bietet, objektive moralische Werte und Pflichten wahrscheinlich zu machen. Er weist die Unwahrscheinlichkeit des atheistischen moralischen Platonismus nach und zeigt überzeugend, dass das Euthyphron-Dilemma für die theistische Ethik kein wirkliches Dilemma darstellt. [Anm. der Red.: Es geht um die Frage, ob etwas deswegen ethisch richtig ist, weil es dem Willen Gottes entspricht, oder ob es an und für sich ethisch richtig ist und deshalb von Gott gewollt wird. Christliche Philosophen entgegnen meist: Gott ist gut. Er entscheidet gemäß seinem Charakter und ist sich selbst Maßstab.] Im Kontrast dazu kann Antonys Aufsatz nur darüber spekulieren, wie natürliche Selektion auf Wahrheit ausgerichtete moralische Reaktionen erzeugen könnte (eine von Richard Joyce und Sharon Street rundweg widerlegte Sicht). Auch verkündet Antony das Euthyphron-Dilemma enttäuschenderweise ganz so, als hätten Jahrzehnte akademischer Arbeiten im Bereich Metaethik, die das Euthyphron-Dilemma längst widerlegt haben, nicht stattgefunden. Und wenn Antony behauptet, dass moralische Rechenschaft in Beziehungen zwischen gewöhnlichen menschlichen Personen gründen kann, übergeht sie damit eine notwendige Antwort auf diejenigen, die ausführlich argumentiert haben, dass es im Naturalismus keine Personen gibt, und dass menschliche Wesen – was auch immer sie sein mögen – im Naturalismus jedenfalls keinen besonderen Wert haben (siehe J. P. Morelands Werk The Recalcitrant Imago Dei (London: SCM Press, 2009) [dt. sinngemäß etwa: Das widerspenstige Ebenbild Gottes, das nicht verschwinden will].
Interessanterweise taucht genau dieses Problem erneut in dem Austausch zwischen Moreland und Oppy über das Argument vom Bewusstsein auf. Moreland vertritt die Auffassung, dass der Theismus die bessere Erklärung für die Existenz von Bewusstsein ist als der Naturalismus. Denn das Bewusstsein steht im Konflikt mit dem Uniformitätsprinzip der Natur, das Bewusstsein ist kontingent, und aus Sicht des Naturalismus höchstwahrscheinlich nur ein Epiphänomen. Selbst, wenn das Bewusstsein auf vorhersagbare Weise auftritt – so Moreland –, würde dies für den Theismus sprechen. Oppys Antwort auf Moreland schließt auch eine Beschwerde dagegen ein, wie Moreland Begriffe verwendet: „Es ist ein Kategorienfehler zu sagen – wie Moreland es tut – dass eine Theorie gegenüber einer anderen eine Antwort unterstellt, die erst noch zu beweisen wäre“ (Fußnote 17, S. 143). Hier macht er es sich angesichts dessen leicht, dass Morelands Gedanke offensichtlich ist: Naturalisten können nicht behaupten, dass die bloße Konsistenz des Naturalismus mit bestimmten Daten als Bestätigung des Naturalismus gilt, wenn der Theismus eine bessere Erklärung dieser Daten liefert, und sie können nicht einfach versichern, dass Phänomene wie „Qualia und libertäre Freiheit … nun mal philosophisch problematisch sind“ (S. 141), wenn sie nur ein Problem für Naturalisten darstellen, hingegen eine enorme prima facie-Plausibilität im Falle des Theismus haben bzw. mit dem Theismus sehr gut vereinbar sind. In seiner Antwort auf Moreland scheint Oppy öfters davon auszugehen, dass eine als vorgefasste Meinung vertretene naturalistische Ontologie mehr Geltung besitzt als offensichtliche Fakten.
Auf der anderen Seite sind einige der Debatten sehr aufschlussreich. Richard Gale mahnt – zurecht, wie ich finde – dass uns der „skeptische Theismus“ als Antwort auf das Problem des Bösen nur bedingt weiterhilft. (Der „skeptischen Theismus“ vertritt, dass unsere Erkenntnisfähigkeit zu begrenzt ist, um wissen zu können, ob Gott nicht doch gute Gründe hat, das Böse zuzulassen.) Denn letztendlich riskiert man mit dieser Strategie eine Nähe zum Ockhamismus, gemäß dem wir nicht wissen, was wir meinen, wenn wir sagen: „Gott ist gut“. Daher „könnte der skeptische Theismus die theistische Hypothese jeglicher Bedeutung berauben“ (S. 206). Dies zeigt, so Meister, dass der Theist eine Erklärung dafür benötigt, warum Gott oft nicht in den Lauf der Welt eingreift. Diese Erklärung müsste eine Art Grenze zwischen Dingen, die Gott tun oder nicht tun würde, deutlich machen. Wie Meister vorschlägt, ist vieles von dem Bösen, welches Gott zulässt, durch die Art gerechtfertigt, wie sich Seelen entwickeln, denn dies beinhaltet, „schwierige moralische Entscheidungen zu treffen“ (S. 214). Zwar ist mir diese Sichtweise sympathisch, jedoch werden manche Leser Meisters Behauptung in Frage stellen, dass auch das natürliche Übel angesichts eines evolutionären Prozesses, welcher „fühlende moralische Wesen wie uns“ (S. 214) hervorgebracht hat, unvermeidbar wird. Es ist nämlich überhaupt nicht klar, dass Gott auf solche Prozesse angewiesen war, und dies scheint Gott mitschuldig zu machen bei der Erzeugung des Bösen. Andererseits hat Meister sicherlich recht, wenn er sagt, dass der Naturalismus ein viel größeres Problem des Bösen hat, da er keine glaubwürdige Erklärung dafür bietet, was das Böse ist oder was es bedeutet.
Es liegt in der Natur der Sache, dass sich manche Leser bei einigen Diskussionen nicht vertreten fühlen, da sie sich keiner der beiden Sichtweisen anschließen können. In der Diskussion über Evolution und Glauben an Gott schreibt Joseph Bulbulia, dass „evolutionäre Psychologie zeigt, wie religiöse Glaubensüberzeugungen möglicherweise entstanden sind, ohne dass irgendwelche Götter existieren, die diese verursacht haben“ (S. 225). Michael Murray und Jeffrey Schloss antworten, dass im Theismus auch dann, wenn man darwinistische Evolution unterstellt, „Gott ein Teil der kausalen Verursachungskette ist, die dazu geführt hat, dass wir übernatürliche, den Glauben erzeugende, Mechanismen besitzen“ (S. 215). Somit könnte Gott sowohl indirekt als auch direkt als Ursache des theistischen Glaubens gewirkt haben. Dann stochern wir allerdings im Nebel, denn die darwinistischen Prozesse würden anscheinend genau gleich ablaufen, egal ob Gott existiert oder nicht; selbst wenn sie zu wahren theistischen Glaubensüberzeugungen führten, wären diese ein glücklicher Zufall, aber die so erzeugten Überzeugungen wären kein Wissen. Der einzige Weg, nachzubessern, so dass die glaubenserzeugenden Prozesse zuverlässig sind, bestünde darin, an gewisse „äußere Zwänge“ zu appellieren, die dann teleologischer Natur sind, wodurch der Ansatz aber nicht mehr rein darwinistisch wäre. Wenn unser Geist nicht planvoll so geschaffen worden ist, dass theistische Glaubensüberzeugungen entstehen (eine Sicht, die mit darwinistischer Orthodoxie nicht vereinbar ist), ist schwer einzusehen, wie diese Überzeugungen zuverlässig sein können.
Auf den ersten Blick besteht eine Pattsituation zwischen Stewart Goetz, der eine immaterielle Seele verteidigt, und Kevin Corcoran, einem „christlichen Physikalisten“ [Anm. der Red.: Der christliche Physikalismus wird von einigen christlichen Philosophen (z. B. Peter van Inwagen) vertreten, die einen Dualismus von Leib und Seele ablehnen und meinen, dass der Mensch nur materielle Bestandteile hat; die Auferstehung von den Toten ist dann einfach die Auferstehung des Leibes mitsamt der Psyche, die als materiell gesehen wird.]. Ausgehend von der Selbstbeobachtung, argumentiert Goetz, dass wir (sich mit der Mehrheit der menschlichen Wesen einig wissend) einfache mentale Wesen sind und erklärt sich als jemand, der erst mal von der Existenz der Seele ausgeht. Corcoran will sich da nicht lumpen lassen und versichert, dass er einfach vom Materialismus ausgeht („Ich bin ein antecedent materialist.“) „Ich steige einfach mit der Grundannahme in diese Diskussion ein, dass ich ein physisches Objekt bin, denn so ist es mir immer erschienen, solange ich denken kann“ (S. 270). Die eigentliche Frage muss aber die folgende sein: Was müssen wir annehmen, um kohärent die Realität erforschen zu können? Sicherlich müssen wir uns selbst als rationale und über die Zeit fortdauernde Wesen betrachten, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass wir Wissen über die physische Welt erlangen können.
Man kann nicht zunächst von der Grundannahme ausgehen, dass man einfach nur ein physisches Objekt wie jedes andere ist, das in rein unpersönlichen Begriffen beschrieben werden kann, und dann eine persönliche Untersuchung über die Realität beginnen. Corcoran gibt zu, dass kein a priori-Argument gegen den Dualismus durchschlagend ist (und er besteht darauf, dass Theisten dies so sehen müssen, denn der Theismus setzt mindestens einen nicht-materiellen Geist voraus, der mit der physischen Welt interagiert). Aber er schlägt vor, dass die Art, wie mentale Fähigkeiten von physischen Fähigkeiten abhängen (z. B. benötigt das Gedächtnis einen funktionalen Hippocampus im Gehirn), anders ist, als wir es im Falle des Dualismus erwarten sollten. Allerdings hängt dies davon ab, um welche Sorte Dualisten es sich handelt. Die meisten Dualisten, mich eingeschlossen, räumen eine enge Abhängigkeit zwischen Seele und Gehirn nicht nur notgedrungen ein, sondern vertreten diese selbst mit Nachdruck, und glauben natürlich, dass Erinnerungen im Gehirn gespeichert werden. Am ungewöhnlichsten ist Corcorans Behauptung, dass zwar Naturalisten keine überzeugende Erklärung des Bewusstseins haben, dass aber die Sicht, es gebe eine Seele, auch nicht überzeugender sei. Dies ist aber sicher der Fall, denn Seelen sind von Natur aus Subjekte, und können, weil sie mentale Substanzen sind, Gedanken zu einem bestimmten Zeitpunkt vereinen (zu untrennbaren Teilen), und können über die Zeit die gleichen bleiben; diese Eigenschaften der Seele erklären doch die Natur des bewussten Denkens sehr gut. Corcorans Spekulationen darüber, wie man den Physikalismus mit dem Leben nach dem Tod in Einklang bringen kann, sind wohlbekannt und aus meiner Sicht völlig ad hoc: Sie müssten eine Ausnahme von der Regel bezüglich der Identitätsbedingung von physischen Objekten fordern, ohne diese Ausnahme zu begründen. Außerdem widersprechen sie klaren Aussagen der Heiligen Schrift (z. B. Mt 10,28; 1Thess 5,23; Offb 6,9–10).
Die Beiträge von Evan Fales und Paul K. Moser über das Thema Wunder passen bedauerlicherweise nicht gut zueinander. Fales kritisiert die Kohärenz des Konzeptes der Wunder und die Glaubwürdigkeit von Wundergeschichten. Eines seiner Argumente ist, dass Wunder die „lokale Erhaltung von Energie und Bewegung“ verletzen (S. 299). Diese Behauptung ist bereits wirkungsvoll von Robert Larmer in seinem Buch The Legitimacy of Miracle (Lanham, MD: Lexington, 2014) sowie von Robin Collins im Aufsatz „Modern Physics and the Energy – Conservation Objection to Mind-Body Dualism“, (American Philosophical Quarterly 45, 1, 2008, S. 31–42), widerlegt worden. Beide wären ideale Diskussionspartner von Fales gewesen. Larmer zeigt, dass die richtige Formulierung des Energieerhaltungssatzes (Energie bleibt in einem geschlossenen System erhalten) nicht bedeutet, dass Energie nicht geschaffen oder zerstört werden könne, wie es in populären Darstellungen oft behauptet wird. Die letztere Feststellung ist ohnehin eine, die kein Theist akzeptieren kann, da sie Gottes Schöpfung des Universums unmöglich machen würde. Und Collins zeigt, dass sowohl die Relativitätstheorie als auch die Quantentheorie plausible Beispiele für Verursachung ohne Energietransfer bieten. Im Gegensatz dazu hat Moser hier einen wichtigen Aufsatz beigetragen, der eigentlich an einen anderen Ort gehört: Moser sagt, dass Gott nicht nur möchte, dass wir einfach als passive Zuschauer die Indizien für Wunder betrachten, sondern dass Gott uns ruft, unser ganzes Wesen transformieren zu lassen, so dass wir die Wunder als Zeichen der Liebe Gottes sehen können. Dies ist eine hervorragende Einsicht, aber sie gehört gewiss in eine Auseinandersetzung mit einem abgebrühten Evidentialisten (sei es ein Atheist oder ein Theist). Mosers großartiger Beitrag ist es, die Wichtigkeit einer holistischen Anthropologie aufzuzeigen, die alle Bereiche unseres Denkens bei der Formung christlicher Überzeugungen einbezieht (und die Folgen der Sünde auf diese Bereiche ernst nimmt). Er hätte als Gegenspieler einen Verteidiger der rein indizienorientierten „Allein-die-Fakten“-Sichtweise verdient.
Es gibt in dem Buch einige weitere kleinere Enttäuschungen. In der Debatte über die historische Zuverlässigkeit des Neuen Testamentes verteidigen weder Stephen T. Davis noch Marcus Borg die Irrtumslosigkeit der Schrift, und in der Diskussion über den historischen Jesus erwarten weder Stephen J. Patterson noch Craig Evans, dass wir aus den historischen Fakten über Jesus die „konfessionellen“ oder „theologischen Wahrheiten“ ableiten können. Gotthold Ephraim Lessings garstiger breiter Graben zwischen kontingenten Tatsachen und letzten Schlussfolgerungen ist hier offensichtlich, und es wäre schön gewesen, an dieser Stelle etwas von einem Gelehrten wie John Warwick Montgomery zu lesen, der sagt, dass wir diesen Graben überbrücken können, und zwar in der Weise, wie Christus selbst die göttlichen und menschlichen Bereiche überbrückt hat.
Andererseits deckt Gary Habermas sehr wirkungsvoll auf, dass es viel eher philosophische Grundannahmen als historische Tatsachen sind, die Skeptiker wie James Crossley am leeren Grab zweifeln lassen und dazu bewegen, die vielen Augenzeugenberichte über den auferstandenen Jesus als trügerische Visionen anzusehen. Habermas’ Ansatz der „minimalen Fakten“ wird selbst auch kritisiert (manche sagen, er mache gegenüber den einseitigen Prinzipien der Bibelkritik zu viele Zugeständnisse), aber er verdeutlicht, warum im Laufe der Zeit eine skeptische Sichtweise nach der anderen gegenüber den historischen Fakten der Auferstehung fallengelassen worden ist. Die Folge ist, dass Kritiker immer weniger Möglichkeiten haben, sich vor den Ansprüchen Christi auf ihr Leben zu verstecken.
Abschließend sei gesagt – und ich bitte alle Autoren um Nachsicht, die ich aus Platzgründen nicht berücksichtigt habe –, dass dieses Buch tatsächlich neue Maßstäbe setzt, und zwar auf so kühne Weise, dass die A-priori-Wahrscheinlichkeit, dass so ein Buch je erscheinen würde, zweifelsohne sehr gering war! Weil es so hohe Ziele setzt, gibt es auch ein paar Fehlzündungen, wie oben angedeutet. Aber das schränkt die monumentale Wichtigkeit dieses Buches nicht ein, das eine dermaßen weitreichende, qualitativ hochstehende Diskussion über den Wert des christlichen Theismus erreicht hat. Jeder ernsthafte christliche Apologet, jeder christliche Philosoph und jeder seriöse Kritiker des Christentums sollte dieses faszinierende Buch lesen.
– – –
Angus Menuge ist Professor für Philosophie an der Concordia University Wisconsin (USA) und Präsident der Evangelical Philosophical Society. Seine Forschungsinteressen gelten der Philosophie des Geistes, der Wissenschaftstheorie und der Apologetik. Außerdem gilt Menuge als ausgewiesener Experte für C. S. Lewis. Die Buchbesprechung erschien zuerst in: Philosophia Christi, Volume 16, No. 2, 2014, S. 451–456. Die Internetseite der herausgebenden Gesellschaft lautet: URL: http://www.epsociety.org. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Herausgebers. Übersetzt wurde der Beitrag von Roderich Nolte. Erschienen ist die deutsche Ausgabe zuerst in Glauben & Denken heute 1/2015, Nr. 15, S. 57–61.
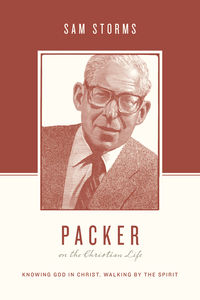 J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv.
J. I. Packer gilt als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten des Evangelikalismus der letzten 100 Jahre. Dabei muss man sich keinen „Grandseigneur“ vorstellen, sondern einen „bescheidenen, demütigen christlichen Gentleman“ (so die Beschreibung des Kirchenhistorikers Carl R. Trueman). Packer ist zur der Erscheinung dieses Buches gegen 90 Jahre alt und noch immer aktiv. Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern?
Als das Buch erschien, war Packer war also 32-jährig. Der Inhalt muss auf dem Hintergrund der Fundamentalismus-Debatte der 50er-Jahre innerhalb Grossbritanniens bedacht werden. „Fundamentalismus“ war noch nicht Sammelbegriff angesichts globaler Herausforderungen wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Packer bezog ihn ausschliesslich auf den „evangelikalen“ Teil der Kirche Englands, der damit „etikettiert“ worden war. Er trägt im ersten Kapitel eine Reihe offizieller Definitionen des Begriffs vor. Genau an dieser Stelle beginnt die inhaltliche Auseinandersetzung: Um drehte sich die Kontroverse? Was war der theologische Kern? Auf meinen Lesestapel liegen hin und wieder Bände aus der katholischen Welt. Nicht nur, weil akademische Arbeit dies gebietet, auch Neugier und Staunen treiben mich an. Im vergangenen Jahr habe ich die Theologische Anthropologie (2011) von Thomas Pröpper und die Katholische Dogmatik (2005) von Gerhard Ludwig Müller studiert. Die Dogmatik ist didaktisch ausgesprochen klug aufbereitet. Pröpper hat mit seinem zweibändigen Werk einen eigenständigen Beitrag zur christlichen Anthropologie geliefert. Seine Darstellung des thomistisch-molinistischen Gnadenstreits (Bd. 2, S. 1351–1401) ist sehr zuträglich. Obwohl ich als reformierter Christ selbsterklärend viele Dinge anders sehe, erweitert die Lektüre meinen Horizont und hilft mir bei der „Versicherung“ meiner eigenen Glaubenspositionen, gerade auch im Blick auf die Gnadentheologie.
Auf meinen Lesestapel liegen hin und wieder Bände aus der katholischen Welt. Nicht nur, weil akademische Arbeit dies gebietet, auch Neugier und Staunen treiben mich an. Im vergangenen Jahr habe ich die Theologische Anthropologie (2011) von Thomas Pröpper und die Katholische Dogmatik (2005) von Gerhard Ludwig Müller studiert. Die Dogmatik ist didaktisch ausgesprochen klug aufbereitet. Pröpper hat mit seinem zweibändigen Werk einen eigenständigen Beitrag zur christlichen Anthropologie geliefert. Seine Darstellung des thomistisch-molinistischen Gnadenstreits (Bd. 2, S. 1351–1401) ist sehr zuträglich. Obwohl ich als reformierter Christ selbsterklärend viele Dinge anders sehe, erweitert die Lektüre meinen Horizont und hilft mir bei der „Versicherung“ meiner eigenen Glaubenspositionen, gerade auch im Blick auf die Gnadentheologie.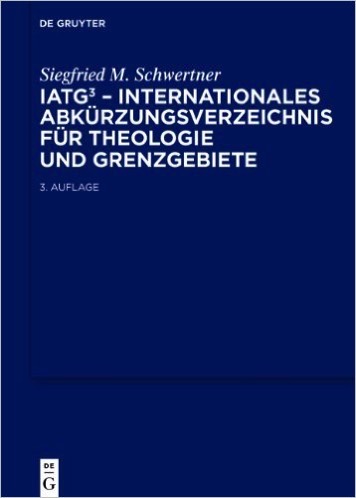 Wer theologische Aufsätze, Hausarbeiten oder Bücher schreibt, sucht nach Möglichkeiten, wiederkehrende Titel von Zeitschriften, Serien, Lexika der Quellenausgaben einheitlich abzukürzen. Ein Beispiel: Sind häufig Werke aus der Reihe „Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament“ zu zitieren, wird man darum bemüht sein, den langen Serientitel zu verkürzen, z. B. durch die die Wahl der Abkürzung „WUzNT“. So spart man sich viel Mühe und Platz. Allerdings ist man als Autor gezwungen, selbst solche Abkürzungen, auch Sigel genannt, zu entwickeln und ein entsprechendes Verzeichnis in die schriftlichen Arbeiten einzufügen. Der Leser wiederum muss sich jeweils mit den Abkürzungen des Autors vertraut machen.
Wer theologische Aufsätze, Hausarbeiten oder Bücher schreibt, sucht nach Möglichkeiten, wiederkehrende Titel von Zeitschriften, Serien, Lexika der Quellenausgaben einheitlich abzukürzen. Ein Beispiel: Sind häufig Werke aus der Reihe „Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament“ zu zitieren, wird man darum bemüht sein, den langen Serientitel zu verkürzen, z. B. durch die die Wahl der Abkürzung „WUzNT“. So spart man sich viel Mühe und Platz. Allerdings ist man als Autor gezwungen, selbst solche Abkürzungen, auch Sigel genannt, zu entwickeln und ein entsprechendes Verzeichnis in die schriftlichen Arbeiten einzufügen. Der Leser wiederum muss sich jeweils mit den Abkürzungen des Autors vertraut machen. Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484).
Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484). Was wäre der aufschlussreichste Test, um herauszufinden, ob das historische Christentum auf dem Marktplatz der Ideen immer noch eine ernstzunehmende Alternative darstellt? Wie wäre es mit einer sorgfältig geplanten Reihe von Diskussionen über alle zentralen Lehren des Christentums (was C. S. Lewis „Bloßes Christentum“ genannt hat), wobei die besten Vertreter aller Richtungen mitdiskutieren – sowohl theologisch Konservative und Liberale, die wichtigsten christlichen Apologeten als auch die stärksten skeptischen Gegner? [Anm. der Red.: Mere Christianity ist der Buchtitel eines von C. S. Lewis veröffentlichten Bestsellers, der auf Radioansprachen zwischen 1942 und 1944 zurückgeht und Kernaspekte des Christentums (wie sie von traditionellen christlichen Denominationen geteilt werden) gegen Kritiker verteidigt. In deutscher Sprache ist der Klassiker zunächst erschienen unter dem Titel Christentum schlechthin, heute ist es unter dem Titel Pardon, ich bin Christ. Meine Argumente für den Glauben erhältlich.] Das wäre der Idealfall, allerdings erscheint das Ziel hochgegriffen: persönliche Vorbehalte oder politisch-ideologische Vorgaben könnten es schwierig machen, beide Seiten zur Teilnahme zu motivieren. Und es steht viel auf dem Spiel, denn die Ideen, die in bestimmten akademischen Kreisen als offensichtlich wahr erscheinen, könnten in einem anderen akademischen Umfeld schlichtweg als widerlegt gelten. Weder die Verteidiger noch die Kritiker des Kernbestands des Christentums können diese Debatte völlig sorglos angehen. Beide benötigen eine ordentliche Portion Mut.
Was wäre der aufschlussreichste Test, um herauszufinden, ob das historische Christentum auf dem Marktplatz der Ideen immer noch eine ernstzunehmende Alternative darstellt? Wie wäre es mit einer sorgfältig geplanten Reihe von Diskussionen über alle zentralen Lehren des Christentums (was C. S. Lewis „Bloßes Christentum“ genannt hat), wobei die besten Vertreter aller Richtungen mitdiskutieren – sowohl theologisch Konservative und Liberale, die wichtigsten christlichen Apologeten als auch die stärksten skeptischen Gegner? [Anm. der Red.: Mere Christianity ist der Buchtitel eines von C. S. Lewis veröffentlichten Bestsellers, der auf Radioansprachen zwischen 1942 und 1944 zurückgeht und Kernaspekte des Christentums (wie sie von traditionellen christlichen Denominationen geteilt werden) gegen Kritiker verteidigt. In deutscher Sprache ist der Klassiker zunächst erschienen unter dem Titel Christentum schlechthin, heute ist es unter dem Titel Pardon, ich bin Christ. Meine Argumente für den Glauben erhältlich.] Das wäre der Idealfall, allerdings erscheint das Ziel hochgegriffen: persönliche Vorbehalte oder politisch-ideologische Vorgaben könnten es schwierig machen, beide Seiten zur Teilnahme zu motivieren. Und es steht viel auf dem Spiel, denn die Ideen, die in bestimmten akademischen Kreisen als offensichtlich wahr erscheinen, könnten in einem anderen akademischen Umfeld schlichtweg als widerlegt gelten. Weder die Verteidiger noch die Kritiker des Kernbestands des Christentums können diese Debatte völlig sorglos angehen. Beide benötigen eine ordentliche Portion Mut. Gemäß der Neuen Paulusperspektive (NPP) bezeichnet der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ (griech. δικαιοσύνη θεοῦ) die Bundestreue Gottes. So legt beispielsweise N.T. Wright sehr viel Wert auf diese Interpretation. In seinem Buch Justification: God’s Plan & Paul’s Vision (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2009, S. 164, hier zitiert nach: N.T. Wright,
Gemäß der Neuen Paulusperspektive (NPP) bezeichnet der Ausdruck „Gerechtigkeit Gottes“ (griech. δικαιοσύνη θεοῦ) die Bundestreue Gottes. So legt beispielsweise N.T. Wright sehr viel Wert auf diese Interpretation. In seinem Buch Justification: God’s Plan & Paul’s Vision (Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 2009, S. 164, hier zitiert nach: N.T. Wright,  Wolfhart Pannenberg (1928–2014) war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Ohne Frage gehört er zu den herausragenden Systematischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er hat in seinen Werken den Offenbarungsanspruch des christlichen Glaubens nicht nur vor den Ansprüchen der kritischen Vernunft schützen wollen, sondern in pointierter und scharfsinniger Weise den Diskurs mit den neuzeitlichen Wissenschaften gesucht und die selbstherrliche Vernunft des Weltmenschen angegriffen. Schließlich gehört er – und das allein sagt schon viel – zu den wenigen Intellektuellen, die über die Nietzschelektüre zum Theologiestudium fanden. Wie viele Leute andersherum wegen Nietzsche ihr Theologiestudium abgebrochen oder gar nicht erst angetreten haben, mag ich mir kaum vorstellen.
Wolfhart Pannenberg (1928–2014) war in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Ohne Frage gehört er zu den herausragenden Systematischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er hat in seinen Werken den Offenbarungsanspruch des christlichen Glaubens nicht nur vor den Ansprüchen der kritischen Vernunft schützen wollen, sondern in pointierter und scharfsinniger Weise den Diskurs mit den neuzeitlichen Wissenschaften gesucht und die selbstherrliche Vernunft des Weltmenschen angegriffen. Schließlich gehört er – und das allein sagt schon viel – zu den wenigen Intellektuellen, die über die Nietzschelektüre zum Theologiestudium fanden. Wie viele Leute andersherum wegen Nietzsche ihr Theologiestudium abgebrochen oder gar nicht erst angetreten haben, mag ich mir kaum vorstellen.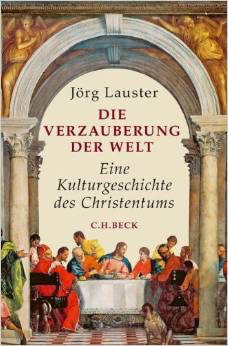 In seiner Kulturgeschichte des Christentums zeigt Jörg Lauster, wie der Glaube seit der Antike nicht nur die Kirche, sondern auch Kunst, Zusammenleben, Wirtschaften, Regieren und Forschen geprägt hat. Seine tragenden Grundüberzeugungen sind deshalb nicht allein in den Lehren und Traditionen der Kirche, sondern ebenfalls auf Gebieten wie Musik, Kunst, Architektur, Literatur oder Wissenschaft zu finden.
In seiner Kulturgeschichte des Christentums zeigt Jörg Lauster, wie der Glaube seit der Antike nicht nur die Kirche, sondern auch Kunst, Zusammenleben, Wirtschaften, Regieren und Forschen geprägt hat. Seine tragenden Grundüberzeugungen sind deshalb nicht allein in den Lehren und Traditionen der Kirche, sondern ebenfalls auf Gebieten wie Musik, Kunst, Architektur, Literatur oder Wissenschaft zu finden.