Nachfolgend ein Auszug aus einer Rezension, die vollständig in der Zeitschrift Glauben & Denken heute erscheinen wird. Besprochen wird folgendes Buch:
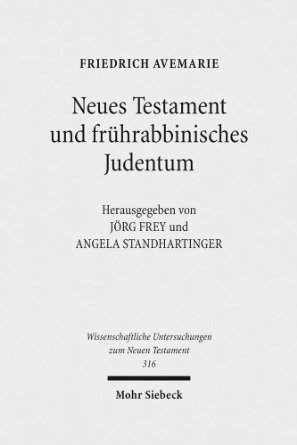 Im Oktober 2012 wurde Friedrich Avemarie unerwartet im Alter von nur 51 Jahren aus dem Leben gerissen. Die Nachricht von seinem Tod traf die Fachwelt wie ein Schlag. Wer immer sich für das Studium der rabbinischen Literatur oder der „Neuen Paulusperspektive“ interessierte, kam an den Beiträgen des Neutestamentlers und Judaisten nicht vorbei. Avemarie wurde 1994 in Tübingen unter Martin Hengel mit der Untersuchung „Tora und Leben“ (Tora und Leben: Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Tora in der frühen rabbinischen Literatur, TSAJ 55, Tübingen, 1996) promoviert. Zwei Jahre nach seiner erfolgreichen Habilitation über die „Tauferzählungen“ in der Apostelgeschichte ging er 2002 an die Universität Marburg und lehrte dort für zehn Jahre. Er verknüpfte großes Interesse für die Auslegung neutestamentlicher Texte mit hervorragenden Kenntnissen der rabbinischen Literatur und leistete in seinem kurzen Leben materialreiche und maßgebende Forschungsbeiträge zum frühen rabbinischen Judentum.
Im Oktober 2012 wurde Friedrich Avemarie unerwartet im Alter von nur 51 Jahren aus dem Leben gerissen. Die Nachricht von seinem Tod traf die Fachwelt wie ein Schlag. Wer immer sich für das Studium der rabbinischen Literatur oder der „Neuen Paulusperspektive“ interessierte, kam an den Beiträgen des Neutestamentlers und Judaisten nicht vorbei. Avemarie wurde 1994 in Tübingen unter Martin Hengel mit der Untersuchung „Tora und Leben“ (Tora und Leben: Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Tora in der frühen rabbinischen Literatur, TSAJ 55, Tübingen, 1996) promoviert. Zwei Jahre nach seiner erfolgreichen Habilitation über die „Tauferzählungen“ in der Apostelgeschichte ging er 2002 an die Universität Marburg und lehrte dort für zehn Jahre. Er verknüpfte großes Interesse für die Auslegung neutestamentlicher Texte mit hervorragenden Kenntnissen der rabbinischen Literatur und leistete in seinem kurzen Leben materialreiche und maßgebende Forschungsbeiträge zum frühen rabbinischen Judentum.
Dankbarerweise haben Jörg Frey und Angela Standhartinger unter Mithilfe von Beate Herbst, der Ehefrau Avemaries, einen stattlichen Aufsatzband in der WUNT-Reihe des Mohr Siebeck Verlags publiziert. Neues Testament und frührabbinisches Judentum versammelt Beiträge zur rabbinischen Martyriumsliteratur, zur Soteriologie, zu Jesu Gleichnissen, zum historischen Hintergrund der Apostelgeschichte, zur Anthropologie, zur Israelfrage und zur paulinischen Rechtfertigungslehre.
Der Züricher Neutestamentler Jörg Frey würdigt einführend das wissenschaftliche Vermächtnis Friedrich Avemaries (S. XII – XXXIII) und führt in die Aufsatzsammlung ein. Da ich die Beiträge nicht einzeln vorstellen kann, knüpfe ich an Freys’ Ausführungen an und stelle dabei Avemaries Untersuchungen zur rabbinischen Soteriologie heraus.
Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts etablierte sich insbesondere in der angelsächsischen Paulusforschung die „New Perspective on Paul“ (NPP). Da Martin Hengel gute Kontakte zu James D. G. Dunn in Durham, einem der Väter der NPP, unterhielt, wurden in Tübingen viele Fragen rund um das neu aufkommende Paulusbild diskutiert. Avemarie greift insbesondere in seiner Dissertation die Fragestellung auf, inwiefern das Heil im frühen Judentum mit der Einhaltung der Thora verbunden war. Gelehrte wie Ferdinand Weber oder Paul Billerbeck zeichneten das Bild eines Judentums, indem der Einhaltung des Gesetzes quasi eine heilbringende Funktion zukam. Die NPP wehrte sich gegen die Darbietung einer jüdischen „Leistungsreligion“. Insbesondere E. P. Sanders sah weniger einen Gegensatz als eine Entsprechung zwischen den Rabbinen und der paulinischen Religionsstruktur. „Auf beiden Seiten identifizierte Sanders eine Struktur, der zufolge der Eingang in das Heil durch Erwählung begründet ist und der Verbleib im Heil ein bestimmtes Verhalten, d. h. ‚Werke‘, voraussetzt. Die Erwählung ist somit grundlegender als die Werke, außerdem sei die Gebotserfüllung im antiken Judentum nicht perfektionistisch verstanden worden, sondern vielmehr seien für jedes Vergehen auch Sühne und Vergebung möglich. So erscheint das gesamte Judentum zwischen Ben Sira und der Mischna ebenso wie das paulinische Denken als ‚Religion der Gnade‘“ (S. XVI).
Wenn also die Gnadenlehre des Paulus der des rabbinischen Judentums sehr weitgehend entspricht, muss zurückgefragt werden, weshalb Paulus das Judentum so scharf kritisiert hat. „Warum wendet sich Paulus so gegen die ‚Werke des Gesetzes‘, wenn diese für das Heil ohnehin nie konstitutiv waren?“ (S. XVI). Sollten die Gesetzeswerke wie Beschneidung oder Reinheits- und Speisegebote nur als Abgrenzungsbestimmungen (engl. ‚boundery markers‘) verstanden werden? Kritisierte Paulus vornehmlich das nationalistische Erwählungsbewusstsein der Juden, das Menschen aus anderen Völkern weiterhin vom Heil ausschloss? Oder hatte Paulus das Judentum schlichtweg missverstanden?
Im Horizont solcher Probleme erforschte Avemarie die Soteriologie der frühen Rabbinen. Seine Monographie „ist methodologisch und sachlich eine der bedeutendsten Arbeiten, die in deutscher Sprache zum antiken Judentum geschrieben wurden“ (S. XVII). Anders als Sanders bricht er Einzelaussagen nicht aus ihrem literarischen Kontext heraus, sondern nimmt sie in ihrem Umfeld wahr, auch dann, wenn sich Einzelaussagen nicht harmonisieren lassen. So gelang Avemarie der Nachweis, dass es im frühen Judentum keine verbindliche Soteriologie gab, sondern bei den Rabbinen unterschiedliche und sogar sich widersprechende Vorstellungen über Erwählung, Gesetz, Bund oder Gnade zu finden sind. „Neben der Forderung, alle Gebote zu halten, steht die realistische Einschätzung, dass die Israeliten dies eben nicht praktizierten und ständig der Sühne bedürften. Und sogleich besteht die Überzeugung unhinterfragt, dass jeder Mensch die Gebote Gottes erfüllen kann“ (XVIII).
Frey schreibt:
„In einem zusammenfassenden Aufsatz zur ‚optionalen Struktur der rabbinischen Soteriologie‘ hat Friedrich Avemarie die Erträge seiner Dissertation selbst knapp resümiert: Was entscheidet für die Rabbinen über das Leben, die Zugehörigkeit zur kommenden Welt? Weder das ,Vergeltungsprinzip‘ dass die Werke eines Menschen über sein Heil entscheiden (so Weber und Billerbeck), noch das ,Erwählungsprinzip‘ dass allein die Zugehörigkeit zum erwählten Volk entscheide (so Moore und Sanders), lässt sich verabsolutieren. ‚Beide Denkmuster lassen sich in der rabbinischen Literatur reichlich belegen‘, die Überordnung der einen These über die andere ist unangemessen. Den theologischen Systematisierungsversuchen entgegen steht die große Fähigkeit der Rabbinen, divergente, ja widersprechende Ansichten im Diskurs zu integrieren und gleichsam ,aspektiv‘ einander zuzuordnen. Nicht eine Position ist allein ,richtig‘, andererseits ist auch nicht alles ,gleich gültig‘ oder beliebig, sondern innerhalb bestimmter Grenzen kann beides gesagt werden. So kann der Heilsverlust von Israeliten (durch Sünde) ebenso ausgesagt werden wie der Heilsgewinn von Heiden (durch Erwählung) – was weder dem Modell von Weber und Billerbeck noch dem von Moore und Sanders entspricht“ (S. XIX).
Die Untersuchung bestätigt damit einerseits die Einsicht der NPP, dass der Apostel Paulus sehr grundlegend vom Denken seiner jüdischen Herkunft geprägt war. Zugleich ist die Annahme eines normativen palästinensischen Judentums vor oder nach dem Jahr 70 unhaltbar. Paulus stand keinem monolithischen Judentum, sondern unterschiedlichen jüdischen Traditionen gegenüber (vgl. S. XX). Noch einmal Frey:
„Die vereinfachende Sicht des zeitgenössischen Judentums unter dem Begriff ,Common Judaism‘ (Sanders), die im Grunde das ältere Modell eines normativen Judentums unter anderen Vorzeichen fortsetzt, erfasst schon die Diversität der rabbinischen Aussagen nicht hinreichend, und noch viel weniger die tiefgreifenden Differenzen zwischen den Religionsparteien zur Zeit des Zweiten Tempels, zwischen Sadduzäern und Pharisäern oder gar zwischen diesen und der sich selbst exklusiv im ,Bund‘ Gottes verstehenden Qumrangemeinde. Nur im Prisma einer simplifizierenden Religionsstruktur kann als gleichartig erscheinen, was im Detail zutiefst strittig ist. Dass die Charakterisierung auch des rabbinischen Judentums unter der einseitigen Priorisierung der Erwählung bzw. der Gnade (wie z. B. bei Sanders) so nicht zutrifft und daneben das Vergeltungsparadigma und der Gedanke von Verdienst und Lohn durchaus Vorkommen, hat Friedrich Avemarie deutlich gezeigt. Paulus trifft also, wenn er solches an einigen seiner jüdischen Zeitgenossen kritisiert, nicht ein Zerrbild, sondern einen Aspekt, der zumindest bei einigen dieser Zeitgenossen und auch bei anderen judaisierenden Jesusnachfolgern durchaus vorgekommen sein dürfte, ebenso wie bei den späteren Rabbinen“ (S. XXI).
Jörg Frey erörtert des Weiteren ausführlich Avemaries Habilitationsschrift zu den Tauferzählungen der Apostelgeschichte und der Geschichte des frühen Christentums, die wie seine Dissertation als Monographie erschienen ist (Tauferzählungen der Apostelgeschichte: Theologie und Geschichte. Tübingen. WUNDT 139, Tübingen 2002). Avemarie distanzierte sich zwar verhalten von den konservativen Thesen seines Lehrers Hengel zur Vertrauenswürdigkeit der Apostelgeschichte, wendet sich aber gegen die Tendenz, sie „als eine weithin fiktive oder romanhafte Gründungserzählung zu lesen“ (S. XXV). Auf andere Forschungsthemen Avemaries weist Frey kurz hin, in erster Linie Themen der rabbinischen Literatur, aber auch Ausarbeitungen zur Theologie des Paulus oder zur Jesusüberlieferung. Die wichtigsten Aufsätze sind im Sammelband enthalten.
…
Zum Buch gehören vier bisher nicht veröffentlichte Vorträge aus den Jahren 2007 bis 2011. Neben einer Gesamtbibliographie enthält es alle nützlichen Register. Der Leser wird von Avemaries weitem Horizont und seiner Beobachtungsgabe sehr profitieren. Ein empfehlenswerter Band.
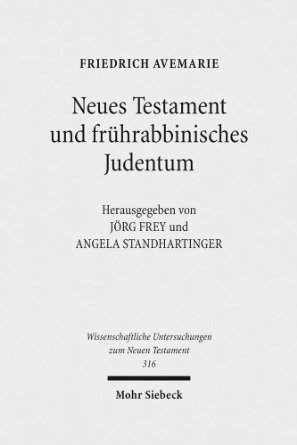
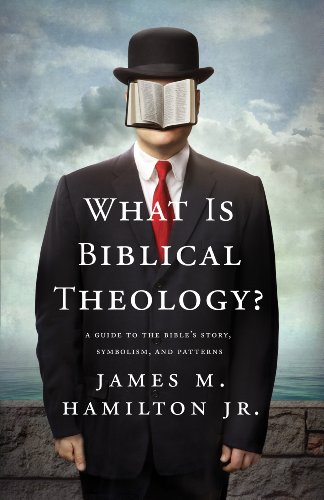 Die neue Ausgabe des Magazins Credo (11/2013) enthält ein Interview mit James Hamilton über das Buch:
Die neue Ausgabe des Magazins Credo (11/2013) enthält ein Interview mit James Hamilton über das Buch: Der Neutestamentler Douglas Moo (Wheaton College, USA) hat N.T. Wrights neues voluminöses Werk über die Theologie des Paulus:
Der Neutestamentler Douglas Moo (Wheaton College, USA) hat N.T. Wrights neues voluminöses Werk über die Theologie des Paulus: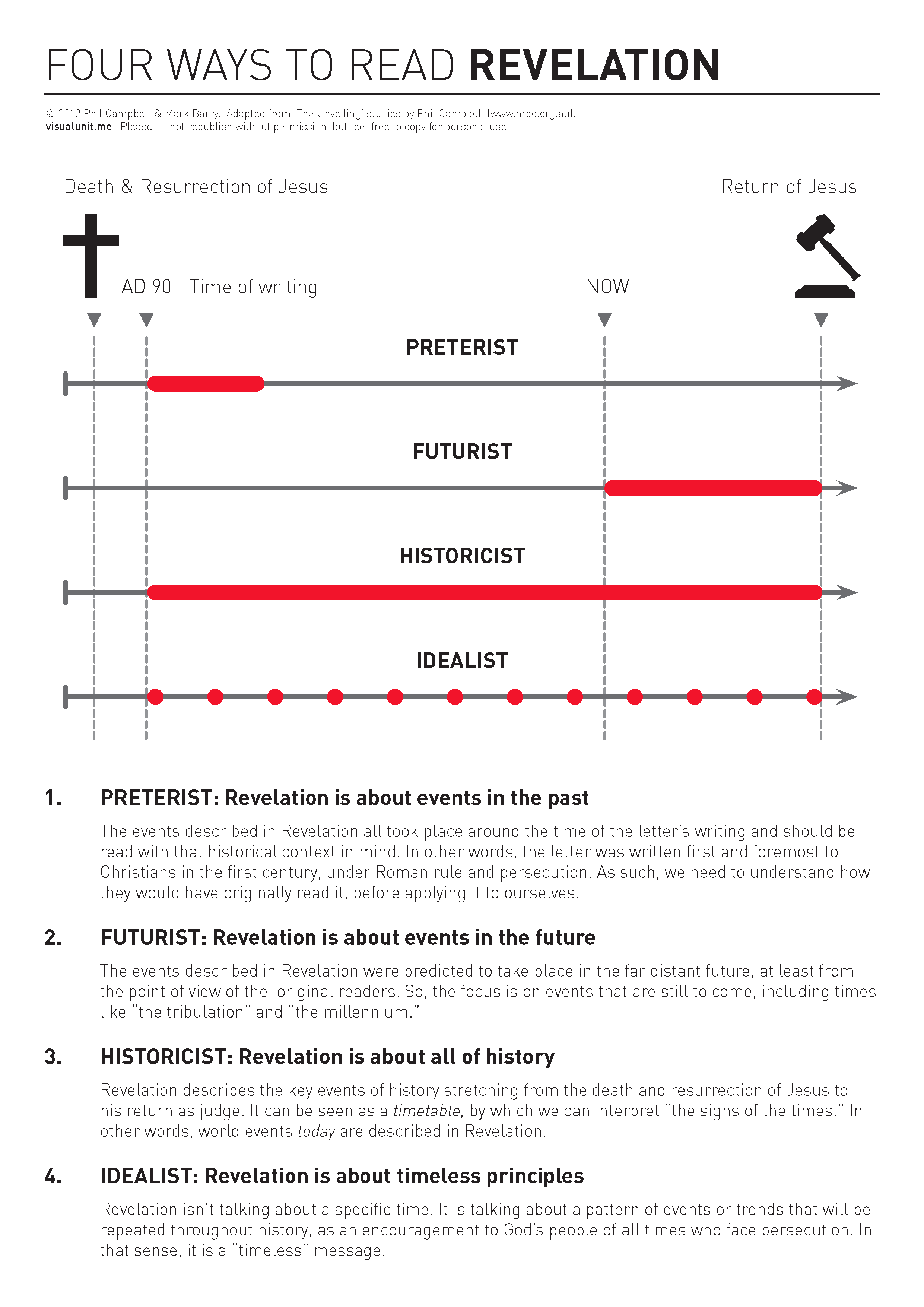
 Gerade ist ein Buch mit Grundsatzbeiträgen über die Lehre der Heiligen Schrift von der Reformation bis in die Gegenwart erschienen. Neben bedeutsamen Bekenntnistexten enthält das Kompendium Beiträge von Oswald T. Allis, William Ames, Herman Bavinck, Louis Berkhof, Henry Bullinger, John Calvin, Edmund P. Clowney, William Cunningham, Raymond B. Dillard, Jonathan Edwards, Sinclair B. Ferguson, John M. Frame, Richard B. Gaffin Jr., Louis Gaussen, Ernst Wilhelm Hengstenberg, Archibald Alexander Hodge, Charles Hodge, John Knox, Peter A. Lillback, Martin Luther, J. Gresham Machen, Adolphe Monod, John Murray, John Owen, Vern S. Poythress, Moisés Silva, Charles H. Spurgeon, Ned B. Stonehouse, Francis Turretin, Zacharias Ursinus, Cornelius Van Til, Geerhardus Vos, Bruce K. Waltke, Benjamin Breckinridge Warfield, Robert Dick Wilson, John Witherspoon, Edward J. Young und Ulrich Zwingli.
Gerade ist ein Buch mit Grundsatzbeiträgen über die Lehre der Heiligen Schrift von der Reformation bis in die Gegenwart erschienen. Neben bedeutsamen Bekenntnistexten enthält das Kompendium Beiträge von Oswald T. Allis, William Ames, Herman Bavinck, Louis Berkhof, Henry Bullinger, John Calvin, Edmund P. Clowney, William Cunningham, Raymond B. Dillard, Jonathan Edwards, Sinclair B. Ferguson, John M. Frame, Richard B. Gaffin Jr., Louis Gaussen, Ernst Wilhelm Hengstenberg, Archibald Alexander Hodge, Charles Hodge, John Knox, Peter A. Lillback, Martin Luther, J. Gresham Machen, Adolphe Monod, John Murray, John Owen, Vern S. Poythress, Moisés Silva, Charles H. Spurgeon, Ned B. Stonehouse, Francis Turretin, Zacharias Ursinus, Cornelius Van Til, Geerhardus Vos, Bruce K. Waltke, Benjamin Breckinridge Warfield, Robert Dick Wilson, John Witherspoon, Edward J. Young und Ulrich Zwingli.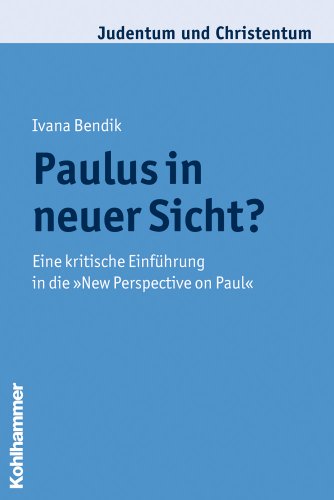 Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):
Mit der „Neue Paulusperspektive“ (NPP) wurde in den letzten vier Jahrzehnten ein neues Kapitel der Paulusinterpretation eröffnet. Die Exegeten dieser Richtung sind sich mehr oder weniger darin einig, dass die Paulusauslegung besonders seit der Reformation einseitig individualistisch und das Judentum fälschlicherweise als Gesetzesreligion verstanden wurde. Die Gesetzespolemik des Apostels richte sich weder gegen die Tora noch gegen deren angeblichen jüdischen Missbrauch im Sinne einer Werkgerechtigkeit, sondern gegen die Beschränkung der göttlichen Erwählung auf das Volk Israel. Viele neue Paulusinterpreten stellen der lutherisch-reformatischen Rechtfertigungslehre eine partizipatorische gegenüber. Das Evangelium ist demnach keine Botschaft der Errettung von Sünde und persönlicher Schuld, sondern Verkündigung der Tatsache, dass Gläubige vollberechtigte Mitglieder des göttlichen Bundes sind. Die Rechtfertigungslehre wird entsprechend nicht mehr in der Anthropologie oder Soteriologie, sondern in der Ekklesiologie angesiedelt. N.T. Wright schreibt beispielsweise (What St. Paul Really Said, S. 119):