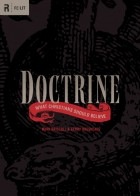Klaus-Peter Jörns spricht in seinem Interview mit dem Rheinischen Merkur (RM) aus, was viele Theologen denken:
RM: Sie glauben also nicht an die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi?
Jörns: Nein. An eine so mirakulöse Geschichte kann ich nicht glauben. Alle Friedhöfe, die ich kenne, zeichnen sich dadurch aus, dass die Bestatteten dort verwest sind und nur die Knochen übrig bleiben. Mit Jesus wird es genauso gewesen sein.
RM: »Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig«, heißt es im 1. Korintherbrief des Apostels Paulus. Ist nicht die leibhaftige Auferstehung der Kern des christlichen Glaubens?
Jörns: Das ist ein modernes Missverständnis von Auferstehung. Die Moderne versteht die Bildsprache nicht mehr, sondern materialisiert sie. Der Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, wird so zu einem Mirakel. Es wird so getan, als wäre Jesus nicht nur wieder da, sondern als wäre er sogar gen Himmel gefahren. Wohin soll er denn gefahren sein? Das hat keinen Bezug zur Wirklichkeit, wie wir sie kennen. Paulus sagt: Jesus ist der »Erstgeborene von den Toten«. Auferstehung als Neugeburt setzt den wirklichen Tod samt Verwesung voraus. Das hat Paulus viel besser verstanden als diejenigen, die nur das Bild vom leeren Grab übernommen haben. Mit Sicherheit hat er auch den griechischen Brauch gekannt, »leere Gräber«, auf griechisch Kenotaphe, als Gedächtnisstätten ohne Leichen zu bauen. Und deshalb hat er den Begriff vom leeren Grab in seinen Auferstehungspredigten nicht verwendet.
Was bleibt da noch vom Auferstehungsglauben? Natürlich das Gefühl der Geborgenheit:
RM: Glaube drückt immer eine Beziehung zwischen Gott und Menschen aus. Das Entscheidende ist, dass Menschen sich in der Beziehung zu Gott geborgen fühlen und lernen, leben und sterben zu können und nicht nur zu müssen. Jesus hat gewusst, dass das Leben schwer ist und dass wir Gottes Liebe und Hilfe brauchen. Weil er sie uns ohne jede Bedingung zugesagt und die Leiden der Menschen geteilt hat, ist er mein Weg zu Gott und zum Leben.
Vielleicht ist ja gerade diese Gefühlsduselei das große erfahrungstheologische (und damit moderne) Missverständnis? Jedenfalls ist für den Philosophen Robert Spaemann die Kluft zwischen historisch-kritischer Theologie und Verkündigung völlig zu Recht unerträglich. Zu dem Umstand, dass viele deutschsprachige Theologen die biblischen Berichte von der Auferstehung nicht für historische Ereignisse halten, sagt er: »Die Jünger von Jesus waren keine Philosophen, sondern Fischer aus Galiläa. Sie haben nicht spekuliert, für sie zählten nur Fakten. Das leere Grab war für sie ebenso ein Beleg für die Auferstehung wie die späteren Erscheinungen des Herrn.«
Und zur Frage, ob Jesus einen Sühnetod gestorben ist, spricht Spaemann auch Klartext: »Es gibt viele Pfarrer, die das heute bestreiten. Sie stellen sich damit aber gegen den Kern der biblischen Botschaft.« Der Sühnetod Jesu löse das Dilemma zwischen Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe. Christus erfülle mit seinem Kreuzestod beides: »Der Gerechtigkeit wird Genüge getan, indem Gott das Unrecht dieser Welt nicht ungesühnt lässt. Zugleich übt Jesus Christus gegenüber uns Menschen Barmherzigkeit, indem er selbst diese Strafe auf sich nimmt.« Für den Menschen seien Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zwei verschiedene Eigenschaften, in Gott aber seien sie vereint.
Hier mehr: www.kath.net.
 Die ARD strahlt während der Ostertage
Die ARD strahlt während der Ostertage