Glauben und Denken heute 1/2013 erschienen
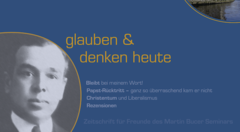 Die 11. Ausgabe der Online-Zeitschrift Glauben und Denken heute (1/2013) ist erschienen und enthält neben zahlreichen Rezensionen u.a. das erste Kapitel aus der deutschen Übersetzung des Buches Christianity and Liberalism von John Gresham Machen. Das Buch Christentum und Liberalismus erscheint im Juli 2013 im 3L Verlag. Übersetzt wurde es von dem GuDh-Redaktionsmitglied Dr. Daniel Facius.
Die 11. Ausgabe der Online-Zeitschrift Glauben und Denken heute (1/2013) ist erschienen und enthält neben zahlreichen Rezensionen u.a. das erste Kapitel aus der deutschen Übersetzung des Buches Christianity and Liberalism von John Gresham Machen. Das Buch Christentum und Liberalismus erscheint im Juli 2013 im 3L Verlag. Übersetzt wurde es von dem GuDh-Redaktionsmitglied Dr. Daniel Facius.
Hier die Beiträge in Glauben und Denken heute:
Artikel
- Johannes Otto: Editorial
- Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher: „Alle Menschen sind Sünder“
- Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher: Ganz so überraschend kam der Papst-Rücktritt nicht
- Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher: Der neue Papst
- Prof. Dr. John Gresham Machen: Christentum und Liberalismus
Rezensionen
- Ron Kubsch: Das Philosophie-Buch: Große Ideen und ihre Denker (Hrsg. v. Will Buckingham, John Marenbon, Douglas Burnham)
- Dr. Daniel Facius: Gott im Fadenkreuz (John Lennox)
- Titus Vogt: Biblische Dogmatik (Wayne A. Grudem)
- Johannes Otto: Die neue Welt und der neue Pietismus (Frank Lüdke, Norbert Schmidt u. a.)
- Dr. Daniel Facius: Hölle – Der Blick in den Abgrund (Carsten Schmelzer)
- Johannes Otto: Bibelsoftware Accordance 10
- Johannes Otto: Der Kanon des Neuen Testaments (Bruce M. Metzger)
- Peter Neudorf: Das Neue Testament und das Volk Gottes (N. T. Wright)
Hier die Ausgabe: gudh011f.pdf.



