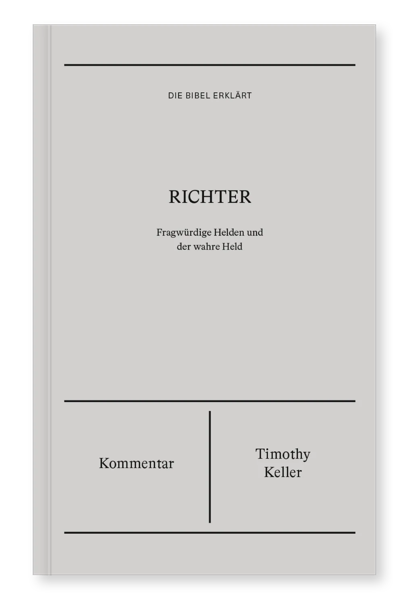David Clark schreibt in To Know and Love God (2003, S. 208–209):
Zu oft in der Kirchengeschichte haben Christen kritisch auf akademische Formen der Theologie reagiert, weil sie meinten, durch sie würde das geistliche Leben abgetötet. Beispiele wie die Great Awakenings, das Aufkommen des Pietismus, Kierkegaards Ablehnung des staatskirchlichen Luthertums und die charismatischen Erneuerungsbewegungen kommen mir in den Sinn. Allzu oft ersetzen Evangelikale heute tote Orthodoxie durch anti-intellektuellen Aktivismus oder Moralismus und nicht mit theologisch vitaler Geistlichkeit. Das unter Evangelikalen am meisten geschätzte Frömmigkeitsmodell betont typischerweise die innere moralische Heiligkeit und den äußeren christlichen Dienst, der im Gegensatz zum reflektierenden Denken steht. Diese Abkoppelung von der säkularen akademischen Welt trug dazu bei, einige Werte zu bewahren: den Vorrang der Bibel und den Respekt vor dem Übernatürlichen. Aber diese Werte überlebten nur innerhalb einer konservativen Subkultur. Der Fundamentalismus überstand den Ansturm der theologischen Moderne, indem er sich zurückzog und eine Festungsmentalität pflegte, die sich gegen die Welt richtete und sich von ihr abgrenzte. Da die akademische Welt als Teil dieser gefallenen Welt angesehen wurde, überließen die Fundamentalisten und später die Evangelikalen die universitäre Welt weitgehend den liberalen Protestanten, die sowohl Traditionalisten als auch Katholiken ausschlossen.
Das Ergebnis ist, dass sich die evangelikale Theologie nicht nur von der akademisch orientierten Universität, sondern auch von einer pragmatisch orientierten Kirche entfremdet hat. Der letztgenannte Punkt ist vielleicht der schädlichste, weil eine der Hauptaufgaben der Theologie als sapientia darin besteht, den Glauben, die Erfahrung und den Charakter der Christen zu formen und zu lenken. Und dies ist sicherlich von zentraler Bedeutung für das Leben und den Auftrag der Kirche. Die Theologie definiert den Gegenstand des christlichen Glaubens. Als solche muss sie sowohl den dreieinigen Gott verherrlichen als auch eine echte persönliche Transformation des einzelnen Gläubigen, der Kirchengemeinschaft und letztlich der Welt bewirken. In der Tat kann die Kirche die Theologie nicht umgehen, wenn sie versucht, ihren Auftrag zu erfüllen. Auch wenn einige meinen, sie könnten die Theologie außer Kraft setzen, die akademische Stratosphäre vermeiden und praktische Relevanz erreichen, gelingt es ihnen nur, eine wohlüberlegte Theologie durch ein Sammelsurium theologischer Bruchstücke zu ersetzen, die wahllos mit kulturellen Ideen verwoben werden.