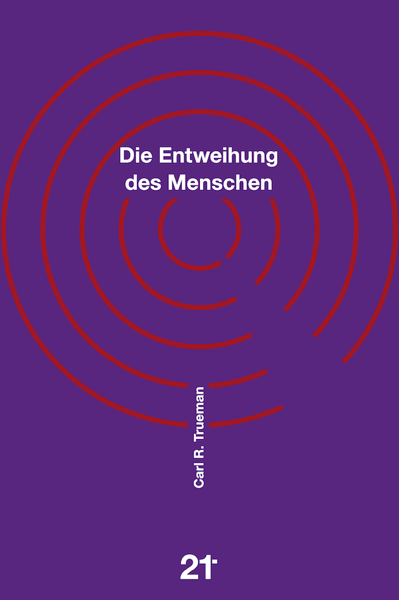In dem Vortrag „Gedenkt der Tage, in denen ihr viel Leidenskampf erduldetet“ habe ich im Januar 2025 über Grenzen der christlichen Gehorsamspflicht gesprochen. Das Volk Gottes soll einerseits gegenüber der weltlichen Stadt eine wohlwollende Haltung einnehmen und der Obrigkeit gehorchen. Was aber, wenn von der Kirche etwas verlangt wird, was in Gottes Augen ein Gräuel ist? Im Vortrag heißt es:
Diese Gehorsamspflicht ist für uns leicht anzunehmen, solange wir voraussetzen, dass die Obrigkeit die Übeltäter bestraft und diejenigen, die Gutes tun, unterstützt. Schwieriger wird es, wenn nicht mehr so klar erkennbar ist, ob die Obrigkeit wirklich das Gute will.
Wie verhalten wir uns in einer Zeit des Umbruchs? Das Abendland öffnet sich mehr und mehr für Maßstäbe, die im Widerspruch zu den Ordnungen stehen, die der Schöpfer dieser Welt eingestiftet hat. Wie wollen wir uns da verhalten?
Die kurze Antwort lautet: Wir können nicht bei allem mitmachen! Es gibt eine Gehorsamsgrenze: Wenn weltliche Anforderungen gegen Gottes Willen verstoßen, gilt: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29). Dieses „mehr gehorchen“ in Apg 5 steht im Kontext der Evangeliumsverkündigung. Die Apostel wollten sich keinesfalls verbieten lassen, im Namen von Jesus zu lehren. Christen sind berufen, durch ihre Worte und ihr Leben ein Zeugnis für Gottes Liebe und Wahrheit abzulegen, sogar dann, wenn es ihnen verboten wird.
Aber auch am allgemeinen Aufstand gegen Gottes Maßstäbe dürfen wir uns nicht beteiligen (prophetisches Amt, schöpferische Gegenkultur). Wir können uns den damit verbundenen Konflikten nicht mehr einfach dadurch entziehen, dass wir uns verstecken. In immer mehr Bereichen des alltäglichen Lebens wird Christen eine Entscheidung abverlangt.
Wie schwer solche Konflikte in der Praxis wiegen können, möchte ich an einem Brief von Präses D.E. Wilm illustrieren. Wilms erzählt in einem Schreiben, dass er Karl Barth zum 70. Geburtstag zukommen ließ, den Einsatz der Bekennenden Kirche im Jahre 1940 gegen das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten.
Um was ging es? Im Frühjahr und Sommer 1939 begann eine Planungsgruppe mit der Organisation einer geheimen Aktion zur Ermordung behinderter Kinder. Am 18. August 1939 erließ das Reichsinnenministerium einen Erlass, der alle Ärzte, Schwestern und Hebammen verpflichtete, Neugeborene und Kinder unter drei Jahren, die Anzeichen einer schweren geistigen oder körperlichen Behinderung aufwiesen, zu melden. Ab Oktober 1939 drängten die Gesundheitsbehörden die Eltern behinderter Kinder, ihre Kleinkinder in eine der dafür vorgesehenen Kinderkliniken in Deutschland und Österreich zu geben. In Wirklichkeit waren diese Kliniken Tötungsanstalten. Eigens angeworbenes medizinisches Personal verabreichte den Kindern tödliche Überdosen von Medikamenten oder ließ sie verhungern. Zunächst nahmen die Ärzte und Klinikleiter nur Säuglinge und Kleinkinder in das Programm auf. Mit der Ausweitung des Programms wurden später auch Jugendliche bis 17 Jahre einbezogen. Nach vorsichtigen Schätzungen sind in den Kriegsjahren mindestens 10.000 körperlich und geistig behinderte Kinder durch das Kindereuthanasieprogramm zu Tode gekommen (wiedergegeben in Anlehung an encyclopedia.ushmm.org).
Als die Bekennende Kirche von diesem Programm erfuhr, wusste sie sich in eine Entscheidung gerufen. Sie durfte zur Ausmerzung sogenannten unwerten Lebens nicht schweigen. Was aber genau sollte sie tun?
Präses Wilm schreibt („Nach der Lektüre von ‚Der Schutz des Lebens‘“, in: Antwort, 1956, S. 16–21, hier S. 17–18):
Wir kamen von einer altpreußischen Bekenntnissynode in Leipzig, wohin wir aus Berlin ausgewichen waren. Es war ziemlich gefährlich gewesen, und wir hatten hinter verschlossenen Türen und Fensterläden in einem Gemeindehaus nahe der Thomaskirche getagt. Über ein Jahr war schon Krieg, und darum wurde die Lage der Bekennenden Kirche immer bedrohlicher, zumal sie zu den Verbrechen an Menschen, an den politischen Gefangenen in den Konzentrationslagern, an den Juden und an den russischen Kriegsgefangenen nicht geschwiegen hatte. Über ein Jahr war schon Krieg und darum lief über ein Jahr, seit dem 1. September 1939, die Aktion HITLERs zur Ausmerzung unwerten Lebens, die man dann mit dem Wort „Euthanasie“ umschrieb. Sie lief geheim, aber mit unheimlicher Brutalität. Hunderte, Tausende kranker Menschen waren bereits aus den Heilanstalten verlegt worden und wenige Wochen danach gestorben, sprich: ermordet worden.
Wir wußten das! Landesbischof WURM hatte in seinem Brief an den Reichsinnenminister diese Verbrechen beim Namen genannt und Anklage gegen die Mörder erhoben. Wir brachten damals von dieser Leipziger Synode eine Tageszeitung aus Leipzig – nur von einem Tag mit nach Hause, in der allein vier bis fünf Todesanzeigen standen, die bei näherem Zusehen klar als Anzeigen von diesem Ausmerzungstod zu erkennen waren. Und dann haben wir einander zu Hause in unserer Kirche gefragt: Müssen wir jetzt nicht laut sagen, rufen, schreien, daß hier unschuldige und hilflose Menschen ermordet werden von einer Obrigkeit, die für den Schutz des Lebens verantwortlich ist, und von Ärzten, deren höchstes Gesetz es sein muß, Leben zu erhalten, zu retten und zu heilen? Muß sich die christliche Gemeinde nicht jetzt ganz offen vor diese Kranken, ihre „geringsten Brüder“ stellen und bereit sein, die Folgen solchen Eintretens auf sich zu nehmen? Ich hatte als Kandidat in Bethel eine Zeitlang Epileptiker und Geisteskranke gepflegt und war zwei Jahre Pastor in einer Betheler Zweiganstalt gewesen, und es war von daher sehr eindrücklich die Achtung vor dem ärmsten Menschenleben mit mir gegangen. Was hatten wir an Dankbarkeit für empfangene Liebe und an rührender Anhänglichkeit unter unsern Kranken erfahren; ja, wie hatten sie uns zuweilen, wenn der Vorhang der Dunkelheiten ihrer Krankheit sich mal ein wenig lüftete, beschämt, weil wir dann ihren Glauben oder irgendeine sehr klare menschliche Erkenntnis sahen.
Es gab dann unter uns manche Aussprachen, und wir wurden gefragt, ob die Kirche zu diesem Verbrechen reden müsse und dürfe oder nicht, ob sie berufen sei, den Staat anzureden, ob wir Propheten sein könnten wie Nathan oder Hesekiel oder nicht nur Prediger des Evangeliums innerhalb unserer Gemeinden, ob Jesus etwas zu den Verbrechen des römischen Kaisers gesagt habe, und wir konnten nur immer wieder antworten, daß hier Menschen gemordet werden, die uns doch als unsere „geringsten Brüder“ anvertraut sind, und daß wir das wissen und darum für sie irgendwie eintreten müssen, daß wir Gottes Willen zu verkündigen haben, wie es Christus selbst getan und uns befohlen hat und also die Übertretung dieser Gebote strafen müssen in der Gemeinde und in der Welt.
Es gab das Ringen BODELSCHWINGHs mit dem Leibarzt HITLERS um das Leben seiner Kranken, das zugleich ein Ringen um diesen „Arzt“ war und bei dem BODELSCHWINGH sich selbst vor seine Pflegebefohlenen stellte.
Es gab unter uns stille Verabredungen der Brüder – keine Weisung einer Kirchenleitung! –, daß wir in dieser Sache nicht schweigen wollten, und manch einer hat das Wort gesagt „zum Schutz des Lebens“, indem er sein eigenes Leben aufs Spiel setzte, manch einer hat am Grabe eines so ermordeten Gemeindegliedes, dessen Urne mit einem Lügenbrief aus der Tötungsanstalt geschickt wurde, offen erklärt: „Dieser Bruder ist nicht auf natürliche Weise gestorben; an ihm ist ein Mord geschehen.“ Was das mitten im Kriege bedeutete, braucht wohl nicht gesagt zu werden. Aber es ist mir in meiner langen Gefangenschaft ein großer Trost in Stunden dunkler Anfechtung gewesen, daß auf meinem Schutzhaftbefehl, unterschrieben vom Gestapockef HEYDRICH, gestanden hatte: „Er hat durch öffentliche Stellungnahme zur Euthanasie Unruhe in die Bevölkerung getragen usw.“