Inzwischen mehren sich Wortmeldungen, die vor einer Übergriffigkeit der Gender Studies warnen. Die Genderforschung in der Tradition von Judith Butler setzt voraus, dass das Geschlecht nur ein soziales Konstrukt ist und von einem Individuum durch einen reinen Sprechakt entworfen werden kann (z.B. „Ich fühle mich als Mann.“). Das Geschlecht steht demnach nicht in einer Beziehung zum Körper, sondern kann sich in gnostischer Weise von leiblichen Vorgaben emanzipieren.
In der englischsprachigen Welt organisieren sich inzwischen Naturwissenschaftler, die eine Vereinnahmung der Naturwissenschaft durch Gender-Ideologen wahrnehmen (siehe dazu das „Project Nettie“). Aber auch in Deutschland formiert sich Protest gegen diesen unwissenschaftlichen Essentialismus eines gefühlten Geschlechts. Hans Peter Klein, emeritierter Professor für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt, warnt etwa davor, dass die Gender-Forschung in etliche Fachbereiche hineinregiert. Die FAZ schreibt in der heutigen Ausgabe (18.08.2021, Nr. 190, S. N 4):
Das bedeutet nichts anderes, als dass jetzt die Biologie, erforscht durch alte weiße Männer, komplett neu erforscht werden muss aus der Perspektive einer politischen Ideologie heraus“, sagt Hans Peter Klein, emeritierter Professor für Didaktik der Biowissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt. Besonders verwundert ihn die Übergriffigkeit und eine gewisse kulturalistische Arroganz: „Es ist ein Kennzeichen aller Fachbereiche, sich nicht in die Inhalte anderer Fachbereiche einzumischen. Die Gender Studies aber schwingen sich zu einer Metadisziplin auf, die genau das betreiben.
Gerade im Raum der medizinischen Genderforschung wird deutlich, dass es elementare Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Vera Regitz-Zagrosek, Kardiologin und Gründungsdirektorin des „Berlin Institute for Gender in Medicine“ an der Charité Berlin, erklärt das am Beispiel des Immunsystems:
So ist zum Beispiel das Immunsystem der Frauen schlicht ein anderes: Es ist effektiver in der Abwehr akuter Infektionen wie zum Beispiel mit Coronaviren. Männer sterben deutlich häufiger an Covid-19 … Die Immunantwort weiblicher Entzündungszellen ist selbst in der Petrischale deutlich unterscheidbar von der männlicher Entzündungszellen. (Ebd.)
Die FAZ fasst die Sichtweise von Hans Peter Klein so zusammen:
Selbstverständlich spielen Rollenklischees, Zuschreibungen, Kultur und Tradition eine Rolle bei Gesundheit und Krankheit – auch diese Aspekte bezieht die Gendermedizin mit ein. Daher auch der Name der Disziplin, schließlich benennt „Gender“ das soziale Geschlecht, „Sex“ das biologische. Doch empirisch belegt ist eben auch die Tatsache, dass biologisches Geschlecht sehr wohl außerhalb von gesellschaftlichen Zuschreibungen existiert – es ist Fakt, dass für Menschen kein anderer Fortpflanzungsweg existiert als über die Zweigeschlechtlichkeit. Es ist gerade Kennzeichen der naturwissenschaftlichen Forschungsmethodik, dass sie ihre Thesen mit Daten beweisen muss. Sichere Medikamente und Impfstoffe müssen verschiedene Phasen der Erkenntnisgewinnung erfolgreich durchlaufen, bevor sie auf den Markt kommen, ansonsten werden sie verworfen. „Dies steht im Gegensatz zu einer Ideologie, die wie die Gender Studies ihre Theorie gerade nicht empirisch untermauern, sondern als eine Wahrheit vorgeben, die keines Beweises bedarf – sehr zum Leidwesen vieler empirisch arbeitender Sozialwissenschaftler, in deren Fachbereich sie meistens verortet sind”, so Hans Peter Klein. (Ebd.)
 Bei Evangelium21 ist die Besprechung zur Studie Freikirchliche Gottesdienste von Stefan Schweyer erschienen. Prof. Schweyer hat freikirchliche Gottesdienste in der Schweiz beobachtet und analysiert und die Ergebnisse in diesem umfangreichen Buch bei der Evangelische Verlagsanstalt publiziert. Dabei sind Interessante Dinge ans Licht gekommen. Zum Beispiel:
Bei Evangelium21 ist die Besprechung zur Studie Freikirchliche Gottesdienste von Stefan Schweyer erschienen. Prof. Schweyer hat freikirchliche Gottesdienste in der Schweiz beobachtet und analysiert und die Ergebnisse in diesem umfangreichen Buch bei der Evangelische Verlagsanstalt publiziert. Dabei sind Interessante Dinge ans Licht gekommen. Zum Beispiel: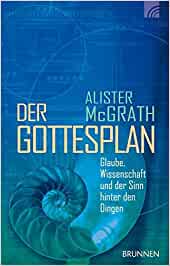 Alister McGrath über die erkenntnistheoretische Bedeutung des Glaubens für C.S. Lewis (Der Gottesplan, Geißen: Brunnen, 2014):
Alister McGrath über die erkenntnistheoretische Bedeutung des Glaubens für C.S. Lewis (Der Gottesplan, Geißen: Brunnen, 2014):