Kreuz, Rechtfertigung und Werke
Der Reformator Martin Luther sagt in Thesen für fünf Disputationen über Röm 3,38 (1535–1537), (in: G. Wartenberg, W. Härle, & J. Schilling (Hrsg.), Christusglaube und Rechtfertigung: Deutsche Texte, Bd. 2, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2005, S. 405–407):
Die Schrift aber bezeugt, dass unser aller Sünden auf ihn gelegt sind und er für die Sünden des Gottesvolkes durchbohrt wurde und wir durch seine Wunden geheilt sind. Auf diese Weise umsonst gerechtfertigt, tun wir daraufhin Werke, vielmehr tut Christus selbst alles in uns. Denn wenn keine Werke folgen, dann ist es gewiss, dass nicht dieser Glaube an Christus in unserem Herzen wohnt, sondern der tote Glaube, den man als erworbenen Glauben bezeichnet.
Zwar gilt die Predigt des Wortes allen, wie geschrieben steht: „Ihr Schall geht aus in alle Lande.“ Aber dieser Glaube entsteht nicht bei allen, wie geschrieben steht: „Wer hat unserem Predigen geglaubt?“
Alle aber, die verbreiten, dass die Werke vor Gott rechtfertigen, zeigen, dass sie nichts von Christus oder vom Glauben verstehen.
Wir bekennen, dass gute Werke auf den Glauben folgen müssen, vielmehr nicht müssen, sondern ihm von selbst folgen, so wie ein guter Baum nicht gute Früchte bringen muss, sondern von selbst bringt. Und wie gute Früchte nicht den Baum gut machen, so rechtfertigen gute Werke nicht die Person, sondern gute Werke werden von einer Person getan, die schon zuvor durch den Glauben gerechtfertigt ist, so wie gute Früchte von einem Baum kommen, der schon zuvor auf Grund seiner Natur gut ist.

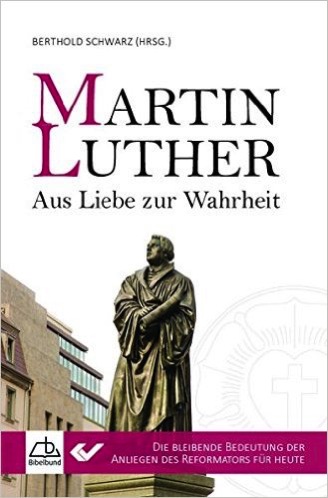 Der Verlag schreibt:
Der Verlag schreibt: