Wir sind wahrscheinlich damit vertraut, dass es im Raum unserer Gemeinden und Kirchen unterschiedliche Auffassungen über den Nutzen der Theologie gibt. Auf der einen Seite des Spektrums haben wir Leute, die überhaupt nicht wiedergeboren sind, aber Theologie studieren. Sie treten mit dem Anspruch auf, dass nur ein studierter Theologe das Recht habe, theologische Aussagen zu machen. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es Christen, die die Theologie für ein Werk des Teufels halten. Sie treten in der Regel sendungsbewusst auf und sind sich – so jedenfalls meine Erfahrung – sehr sicher, dass die Beschäftigung mit der Theologie in den allermeisten Fällen den persönlichen Glauben und die Lehre in der Gemeinde beschädige.
Diese unterschiedlichen Auffassungen über den Nutzen der Theologie lassen sich teilweise dadurch erklären, dass diese Gruppen unter Theologie jeweils etwas anderes verstehen. Die studierten Theologen haben die akademische Theologie im Kopf, die Gegner der theologischen Arbeit verbinden mit der Theologie eher liberale Strömungen, haben jedoch eine hohe Meinung von der biblischen Lehre.
Tatsächlich ist es allerdings so, dass jeder Christ in einem gewissen Sinn ein Theologe ist. Es geht gar nicht um die Frage, ob jemand theologische Überzeugungen hat, sondern vielmehr darum, was für theologische Überzeugungen jemand hat. Entweder ist unsere Theologie gut, das heißt schrifttreu. Oder sie ist schlecht, was bedeutet, dass sie Dinge vernachlässigt, die in der Heiligen Schrift offenbart sind, etwas überbetont oder über Dinge hinausgeht, die in der Schrift stehen (oder unsauber darstellt). Insofern ist in einem gewissen Sinne bereits das Kind in der Sonntagsschule ein „Doktor der Theologe“.
Zugleich müssen wir allerdings feststellen, dass es unterschiedliche Personenkreise oder „Maße“ für die Theologie gibt.
Wir haben (1) eine Theologie für alle Jünger, also eine Laientheologie. Ich gebrauche dieses Wort keinesfalls abwertend, sondern gemäß dem Anliegen des allgemeinen Priestertums. Für diejenigen, die glauben, gilt (1Petr 2,9–10):
„Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Volk, das er sich zu eigen machte, damit ihr verkündet die Wohltaten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr seid die, die einst kein Volk waren, jetzt aber das Volk Gottes sind, die einst keine Barmherzigkeit erlangten, jetzt aber Barmherzigkeit erlangt haben.“
Ein Christ ist von Gott dazu auserwählt, die Wohltaten seines Herrn „auszurufen“, „zu verkünden“ oder „zu proklamieren“ (griech. ἐξαγγέλλω). Dieser Verkündigungsdienst setzt natürlich voraus, dass die Priester mit dem Evangelium vertraut sind. Gläubige des Neuen Bundes haben nicht nur Gemeinschaft miteinander und feiern das Herrenmahl, sie halten fest an der „Lehre der Apostel“ (Apg 2,42). Christen waren einst Sklaven der Sünde, sind aber jetzt von ganzem Herzen „gehorsam geworden der Gestalt der Lehre“ oder der „Wahrheit“, die ihnen durch die Apostel übergeben wurde (Röm 6,17; 1Petr 1,21).
In diesem Sinne ist jeder Christ Priester und insofern ebenfalls Theologe. Er nimmt das Wort Gottes bereitwillig auf und forscht – wenn möglich täglich –, ob das, was er glaubt, mit der Schrift übereinstimmt (vgl. Apg 17,11). Er verkündigt das Wort sich selbst, aber auch seinen Kindern, geistlichen Geschwistern oder Ungläubigen.
Wir haben (2) eine Theologie für die Diener der Gemeinden. Obwohl alles Christen zur königlichen Priesterschaft gehören, sind einige von ihnen mit Aufgaben betraut, die eine besondere theologische Kompetenz erfordern. Ich denke hierbei nicht an die Lehrer und Hirten, sondern an Mitarbeiter, deren Aufgaben bereits ein tieferes Verständnis für die „göttlichen Dinge“ voraussetzen.
In der Apostelgeschichte wird uns davon berichtet, dass die Apostel nicht mehr genug Zeit für das Wort Gottes und das Gebet hatten, da zu viele praktische Tätigkeiten zu verrichten waren (vgl. Apg 6,1–4). Um diesen Umstand zu ändern, wurden Diakone eingeführt, die die Apostel in ihrem geistlichen Dienst entlasten sollten. Obwohl sich die Diakone wohl vor allem um praktische Aufgaben kümmerten, achtete die Gemeinde in Jerusalem darauf, dass diese Männer stark im Glauben und vom Heiligen Geist erfüllt waren. Über Stephanus wird uns berichtet, dass er sich in der konfrontativen Verkündigung bewährt hat, seine Gegner „vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete“ (Apg 6,10).
Es trifft zu, dass von den Diakonen im Unterschied zu den Ältesten keine Lehrfähigkeit erwartet wird (s. 1Tim 3,8–13). Dennoch sollen sie das „Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren“ (1Tim 3,9). Den Ausdruck „Geheimnis des Glaubens“ verwendet der Apostel Paulus anderswo zur Bezeichnung des offenbarten Evangeliums (vgl. 1Kor 2,7ff.; Eph 3,3–9; 1Tim 3,16). Gemeint ist also, dass sie das Evangelium verstanden haben, ihm vertrauen und in Übereinstimmung mit ihm leben.
Bei unterschiedlichsten Diensten in den Gemeinden wird mehr erwartet als ein persönlicher Glaube und charakterliche Festigkeit. Ich denke da an Christen, die Gottesdienst leiten, die Kinder schulen oder Hauskreise führen. Solche Mitarbeiter sollten gründlich in der biblischen Lehre geschult sein.
Wir haben (3) eine Theologie für Hirten, Verkündiger und Lehrer der Gemeinden. Wer in der Gemeinde öffentlich unterrichtet, braucht die „Fähigkeit zu lehren“ (vgl. 1Tim 3,2). Von ihm darf erwartet werden, dass er „sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen als auch die Widersprechenden zu überführen“ (Tit 1,9).
Schließlich haben wir (4) eine Theologie für die Lehrer zukünftiger Lehrer. Wir können das einem Rat entnehmen, den Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus weitergibt (2Tim 2,2): „Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren.“
Ich möchte an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Aber sicher ahnen wir, was gemeint ist: Es gibt erfahrene, begabte und hoffentlich bewährte Lehrer, die bei der Zurüstung zukünftiger Lehrer und Prediger helfen.
Es geht hier freilich nicht um unterschiedliche Theologien für unterschiedliche Kreise, sondern um unterschiedliche Maße der Gottesgelehrtheit mit der einen Lehre des Christus. Von Lehrern wird ein höheres Maß der Gottesgelehrtheit erwartet als von Diakonen, die beispielsweise für die Gemeindefinanzen zuständig sind. Obwohl alle Christen in einem Sinne Priester sind, sind nicht alle Lehrer (1Kor 12,29; Eph 4,11).
Noch etwas: Wem Gott viel anvertraut, von dem wird er auch viel erwarten (vgl. Lk 12,48). Einem Menschen, dem viel gegeben wurde, der aber andere zur Sünde verführt, erwartet am Tag des Gerichts eine sehr harte Strafe. Jesus sagt in Mt 18,6: „Wer aber einen dieser Geringen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es gut, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in der Tiefe des Meeres versenkt würde.“ Hirten, Pastoren und Lehrer haben deshalb eine besonders große Verantwortung. Deshalb warnt Jakobus (Jak 3,1): „Es sollen nicht viele von euch Lehrer werden, meine Brüder! Denn ihr wisst, dass wir als solche ein noch strengeres Urteil empfangen werden“ (vgl. a. 2Kor 11,15). Wer andere Christen durch falsche Lehren verwirrt, „wird das Urteil tragen, wer er auch sei“ (Gal 5,10).
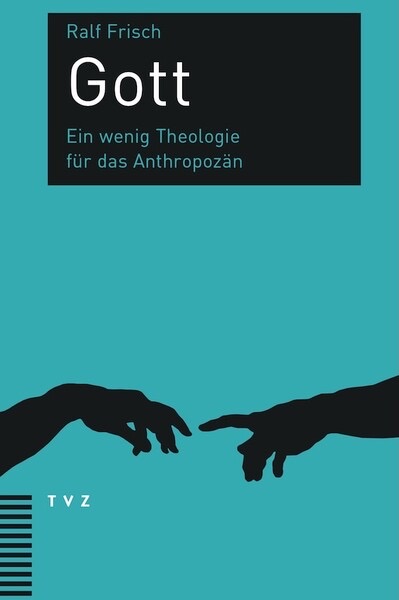

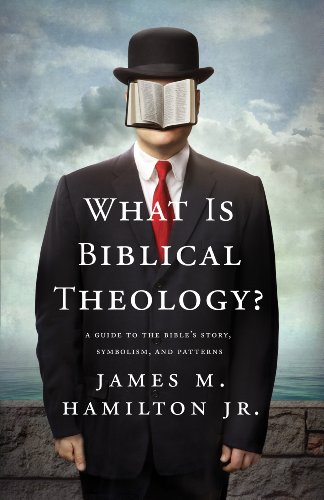 Die neue Ausgabe des Magazins Credo (11/2013) enthält ein Interview mit James Hamilton über das Buch:
Die neue Ausgabe des Magazins Credo (11/2013) enthält ein Interview mit James Hamilton über das Buch: