Wie können wir so tief verdorbenen und selbstsüchtigen Menschen vor einem heiligen Gott bestehen?
Das ›Good-O-Meter‹ ist unbestechlich: youtube.com.
VD: MS
Wie können wir so tief verdorbenen und selbstsüchtigen Menschen vor einem heiligen Gott bestehen?
Das ›Good-O-Meter‹ ist unbestechlich: youtube.com.
VD: MS
Einige Wochen vor meiner Kreuzfahrt berichteten die Nachrichten in Chicago vom Selbstmord eines sechzehnjährigen Jugendlichen. Der Junge war vom Oberdeck eines Luxuskreuzers (entweder der Carnival- oder der CrystalLinie) in den Tod gesprungen, der Medienversion nach aus Liebeskummer, als Reaktion auf eine unglückliche Liebelei an Bord. Ich persönlich aber glaube, dass noch etwas anderes im Spiel war, etwas, über das man in einer Nachrichtenstory nicht schreiben kann.
Denn alle diese Kreuzfahrten umgibt etwas unerträglich Trauriges. Und wie bei den meisten unerträglich traurigen Sachen ist die Ursache komplex und schwer zu fassen, auch wenn man die Wirkung sofort spürt: An Bord der Nadir überkam mich – vor allem nachts, wenn der beruhigende Spaß- und Lärmpegel seinen Tiefpunkt erreichte – regelrecht Verzweiflung. Zugegeben, das Wort Verzweiflung klingt mittlerweile ziemlich abgegriffen, doch es ist ein ernstes Wort, und ich verwende es im Ernst. Für mich bedeutet Verzweiflung zum einen Todessehnsucht, aber verbunden mit dem vernichtenden Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit, hinter der sich wiederum die Angst vor dem Sterben verbirgt. Elend ist vielleicht der bessere Ausdruck. Man möchte sterben, um der Wahrheit nicht ins Auge blicken zu müssen, der Wahrheit nämlich, dass man nichts weiter ist als klein, schwach und egoistisch – und dass man mit absoluter Sicherheit irgendwann sterben wird. In solchen Stunden möchte man am liebsten über Bord springen.
Dieses Zitat stammt aus dem Buch Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich, in dem David Foster Wallace festhielt, was er Mitte der 90er Jahre während einer siebentägigen Reise auf einer Luxuskreuzfahrt beobachtet hat.
Wallace, geboren 1962, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Postmoderne. Sein Lektor Colin Harrison bezeichnete den Amerikaner als »Jahrhundert-Talent«. Seine unterschwellige Neigung zu Depressionen, viele ›Frauengeschichten‹ sowie üppiger Drogen- und Alkoholkonsum stürzten ihn allerdings Anfang der 90er Jahre in eine tiefe Lebenskrise. Wallace über diese Zeit:
Vielleicht kam es dem nahe, was in den alten Zeiten als spirituelle Krise bezeichnet wurde … Das Gefühl, dass sich alles, worauf du in deinem Leben gebaut hast, als trügerisch erweist. Nichts existiert wirklich, du selbst auch nicht, es ist alles eine Täuschung. Nur, dass du besser dran bist als die Anderen, weil du erkennst, dass es eine Täuschung ist, und schlechter, weil du so nicht funktionieren kannst.
 Wallace erholte sich, konnte seinen Zustand mit Hilfe eines Antidepressivums stabilisieren und schrieb neben kleineren Werken den pulverisierenden 1100-Seiten Roman Infinite Jest (wird gerade ins Deutsche übersetzt und soll mit dem Titel Unendlicher Spaß im Herbst 2009 erscheinen).
Wallace erholte sich, konnte seinen Zustand mit Hilfe eines Antidepressivums stabilisieren und schrieb neben kleineren Werken den pulverisierenden 1100-Seiten Roman Infinite Jest (wird gerade ins Deutsche übersetzt und soll mit dem Titel Unendlicher Spaß im Herbst 2009 erscheinen).
Der Roman gilt postmodernen Autoren als wegweisend. Es geht um die mediale Faszination und Ablenkung durch das Fernsehen, um die Frage, warum sich Menschen so viel Mist anschauen. Wallace konkretisiert: »Es geht um mich: Warum mache ich das?« »Charaktere werden entwickelt und verschwinden einfach, Kapitel folgen ohne erkennbaren Zusammenhang aufeinander«, bemerkt David Lipsky in seinem exzellenten Feature über den Romanautor (»Die letzten Tage des David Foster Wallace«, Rolling Stone, Dezember 2008, S. 68–76). »Denn wohin Entertainment letztlich führt, ist ›Infinit Jest‹, das unendliche Vergnügen – das ist der Stern, der den Kurs bestimmt«, erklärt Wallace selbst.
Für Andreas Borcholte war sein Thema die »Suche moderner Menschen nach Zugehörigkeit, Lebensinhalt und Kommunikation. Mit den Mitteln der Ironie und Absurdität und viel Sinn für den Jargon des Alltags versuchte der brilliante Stilist, das Dauerfeuer aus Informationen und Soundbites, das zu jeder Zeit aus Fernsehen, Radio und Internet auf die Menschen niederprasselt, zu durchbrechen, indem er es in seiner ganzen Bedeutungslosigkeit darstellte« (Spiegel online vom 14.09.2008) .
Mit Infinit Jest gelang Wallace der Durchburch und er erntete kolossalen Ruhm. Doch am 12. September 2008, in so einer Stunde, in der man am liebsten über Bord springen möchte (siehe Zitat oben), erhängte er sich (siehe den Beitrag hier im Blog). Seine Frau Karen Green fand ihn in ihrem gemeinsamen Haus, als sie vom Einkaufen zurückkehrte.
Wallace war nicht nur hochbegabt, sondern zerstörerisch kritisch, auch gegenüber sich selbst. Als Sohn eines Philosophieprofessors hatte er gelernt, Vordergründiges zu hinterfragen. Er, der Mathematik, Literatur und Philosophie studierte und zudem ein erfolgreicher Tennisprofi war, durchschaute entzaubernd, wie sehr die unendliche Entertainisierung der Gesellschaft die Menschen verfremdet. Wallace sah den Abgrund, keinen Ausweg.
Ich frage mich: Was hätte Wallace im evangelikalen Mainstream gefunden? Die ihm so vertraute Kultur der Zerstreuung, eben nur eine andere Spielart? Eine fromme Form der Idenditätskrisenbewältigung? Menschen, die sich durch geistliche Übungen vor der Härte der wirklichen Welt schützen? Eben all das, was einer eh kennt, wenn er aufgeweckt durchs Leben zieht?
Oder wäre Wallace bei uns dem frohmachenden Evangelium von der uns in Jesus Christus zugewandten Gnade Gottes begegnet? Hätte er vernehmen können, dass Jesus gern Sünden vergibt und kranke Seelen heilt. Das er genau die Menschen sucht, die an sich selbst verzweifeln, gern denen Ruhe schenkt, die »niedergedrückt und beladen« sind (Matthäusevangelium 11,28, vgl. auch 9,12)?
 Bis in den 70er Jahren lebten mehr als 200.000 syrisch-orthodoxe Christen in der türkischen Region Tur Abdin (im Südosten), wo sie seit jeher leben. Heute sind diese mit 3000 Bewohnern eine schwindende Minderheit. Die meisten flohen nach Westeuropa. Geschätzte 90.000 von ihnen leben in Deutschland.
Bis in den 70er Jahren lebten mehr als 200.000 syrisch-orthodoxe Christen in der türkischen Region Tur Abdin (im Südosten), wo sie seit jeher leben. Heute sind diese mit 3000 Bewohnern eine schwindende Minderheit. Die meisten flohen nach Westeuropa. Geschätzte 90.000 von ihnen leben in Deutschland.
Umso wichtiger ist für die syrisch-orthodoxen Christen ihr 1600 Jahre altes Kloster Mor Gabriel im Tur Abdin. Es ist eines der ältesten christlichen Vermächtnisse und gilt als ihr soziales und religiöses Zentrum und Wallfahrtsort. Die wenigen in ihrer Heimat verbliebenen syrisch-orthodoxen Christen fürchten aber nun erneut um ihre Existenz. Gegen das Kloster Mor Gabriel und den Erzbischof Timotheos Samuel Aktas wurde von drei kurdischen Bürgermeistern aus umliegenden Dörfern Anzeige erstattet.
In den vergangenen Monaten liefen die Prozesse. Dem Kloster wird vorgeworfen, unrechtmäßiges Land besetzt zu haben. Vor dem Klosterbau soll zuvor eine Moschee zerstört und Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren zu Missionarszwecken missbraucht worden sein, lauten weitere Vorwürfe. In Wahrheit ist das Kloster 200 Jahre älter als der Islam und die etwa 70 Mönche und Nonnen unterrichten 40 syrisch-orthodoxen Schüler nachmittags nach dem staatlichen Unterricht lediglich in ihrer aramäischen Muttersprache – der Sprache Jesu.
Einige syrisch-orthodoxe Christen haben die Initiative AKTION MOR GABRIEL gegründet und für den 25. Janunar 2009 um 13:00 Uhr eine Protestkundgebung am Berliner Dom geplant.
Hier mehr Informationen über das Kloster und Einzelheiten zur Kundgebung: www.aktionmorgabriel.de.
Pornografie ist omnipräsent, schon bei Schülern. Heute muss man sie nicht mehr heimlich suchen, sie kommt von allein. Und sie findet dich.
»Was ist daran denn so schlimm?«, fragen viele.
Nebenbemerkung: Manchmal denke ich: »Wird es irgendwann einen Verein geben, der sich um eine menschenfreundliche, christliche Pornografie bemüht?« Die argumentative Begründung dieser neuen diakonischen Dienstleistung stelle ich mir so vor: »Zwar kommt der Begriff ›porneia‹ im Neuen Testament vor. Aber das Konzept, welches die Menschen damals mit dem Begriff verbunden haben, hat wenig mit dem zu tun, was wir heute unter Pornografie verstehen. Außerdem gab es damals weder Internet noch DVDs. Deshalb brauchen wir heute eine Pornografie mit einem christlichen Ethos!«
Aber zurück zum Thema: Pornographie verletzt die Seele und ihr Konsum macht auf die Dauer nicht nur süchtig, er verstellt den Zugang zum wirklichen Leben. Der Ethiker Thomas Schirrmacher vom Institut für Lebens- und Familienwissenschaften (Bonn) hat eine rapide abnehmenden Beziehungsfähigkeit unter jungen Menschen festgestellt. Grund dafür sei die sich ausbreitende sexuelle Verwahrlosung insbesondere unter Jugendlichen. Eine wesentliche Ursache für die mangelnde Beziehungsfähigkeit sieht er in einem ausufernden Pornokonsum selbst unter Kindern:
Im Internet oder auf Videos wird ihnen eine Welt vorgegaukelt, in der Frauen allzeit bereit sind und Männer sich nehmen, was sie wollen. Kinder nehmen so etwas dann für bare Münze, es prägt ihr Bild von einer Beziehung.
Wer wissen möchte (und starke Nerven hat), wie heute junge Leute Pornografie konsumieren, sollte sich diesen Artikel und dieses Interview im Stern durchlesen.
Außerdem empfehle ich zum Thema zwei ausgezeichnete Bücher:
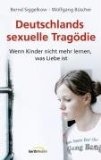 Bernd Siggelkow und Wolfgang Büscher: Deutschlands sexuelle Tragödie: Wenn Kinder nicht mehr lernen , was Liebe ist, Gerth Medien, 2008
Bernd Siggelkow und Wolfgang Büscher: Deutschlands sexuelle Tragödie: Wenn Kinder nicht mehr lernen , was Liebe ist, Gerth Medien, 2008Das Buch beschreibt die Erfahrungen, die die beiden Autoren während ihrer Arbeit mit Kindern in dem Sozial-Projekt »Die Arche« in Berlin gesammelt haben. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, die Ansprechpartner suchen oder Kontakt zu anderen Jugendlichen finden wollen. Die Autoren skizzieren die Lebensläufe und sexuellen Erfahrungen, die aus den Kindern das gemacht haben, was sie nun sind. Und diese Geschichten sind häufig sehr erschreckend und regen zum Nachdenken an.
Das andere Buch widmet sich der Internetpornografie:
 Thomas Schirrmacher: Internetpornografie: … und was jeder darüber wissen sollte, Hänssler, 2008
Thomas Schirrmacher: Internetpornografie: … und was jeder darüber wissen sollte, Hänssler, 2008Schirrmachers Buch setzt sich mit der Pornoindustrie auseinander und untersucht eingehend die Folgen der Internetpornografie und Pornografie auf die Psyche ihres Nutzers. Dafür hat er mehr als 1000 Quellen und Studien ausgewertet. Das Buch zeigt außerdem Lösungswege auf und enthält ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis.
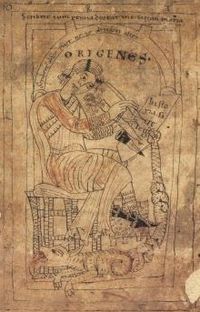 Lee Irons arbeitet gerade an seiner Promotion in Fachbereich Neues Testament am Fuller Theological Seminary. Im Rahmen seiner Studien ist er bei Origenes (185–254 n.Chr.) auf einen Text gestoßen, der Röm 3,21–22 und 10,3 im Lichte von 1Kor 1,30 auslegt. Demnach ist Christus – ganz im Sinne der Alten Paulusperspektive – die Gerechtigkeit Gottes.
Lee Irons arbeitet gerade an seiner Promotion in Fachbereich Neues Testament am Fuller Theological Seminary. Im Rahmen seiner Studien ist er bei Origenes (185–254 n.Chr.) auf einen Text gestoßen, der Röm 3,21–22 und 10,3 im Lichte von 1Kor 1,30 auslegt. Demnach ist Christus – ganz im Sinne der Alten Paulusperspektive – die Gerechtigkeit Gottes.
Origenes kommentiert Röm 3,12 (Migne, Patrologiae Graecae, Bd. 14, Absatz 944):
We can now see what »righteousness« it is that has been manifested apart from natural law. It is the same which the apostle Paul says concerning Christ, that »he has been made unto us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption.« Therefore, this righteousness of God, which is Christ, has been manifested apart from the natural law, but not apart from the law of Moses or the prophets. Natural law teaches us about equity among men or to know that there is a God. But that Christ is the Son of god, who is able to come to know this by nature? Therefore, apart from that law, the righteousness of God, which is Christ, has been manifested, testified to by the law of Moses and the prophets.
Doch ist Christus nicht nur Gottes Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit Gottes wird all jenen frei geschenkt, die sich Jesus Christus im Glauben anvertrauen. Auf diese Weise, nicht durch Werke, werden gläubige Juden oder Griechen gerechtfertigt. Origenes (Absatz 945):
There is, he says, no distinction between Jews and Greeks, since all stand equally made under sin, as he had previously made clear, and now the righteousness of God, supported by the testimonies of the law and prophets, through faith in Jesus Christ is equally given to all … For that reason, the righteousness of God through faith in Jesus Christ coming to all who believe, whether they are Jews or Greeks, justifies those who have been purified from their prior crimes and makes them fit for the glory of God; and it makes them such, not by their merits, nor for their works, but freely offers glory to those who believe.
Hier die ganze Geschichte: www.upper-register.com/blog.
VD: JT
Kurz nach der Vereidigung von US-Präsident Barack Obama am 20. Januar hat das Weiße Haus eine Politikwende in ethischen Fragen signalisiert. Erklärungen zur Abtreibung, zur Familienpolitik und zu Rechten von Homo-, Bi- und Transsexuellen wurden auf der Internetseite geändert. Die neue Regierung möchte durch mehrere Maßnahmen besonders einkommensschwache Familien stärken und gleichzeitig die traditionell ausgerichtete zivilrechtliche Politik der abgewählten Regierung korrigieren.
Weitere Informationen hier: www.idea.de.
Queermergent ist ein Wortspiel, das die Begriffe ›queer‹ und ›emergent‹ miteinander kombiniert. Queermergent steht für ein wachsendes Netzwerk von Christen, die ›emergent‹ und ›LGBTQ‹ zugleich leben möchten (LGBTQ bedeutet: Homosexuelle (G = gay), Lesben (L = lesbian), Bisexuelle (B = bisexual), Transgender-Leute bzw. Transsexuelle (T = transgender/transsexual) sowie Queer-Leute (Q = queer).
Auf einer neuen Internetpräsenz der amerikanischen ›Community‹ heißt es zum Selbstverständnis:
Queermergent ist ein Ort für Leute, die sich als LGBTQ verstehen und einen Platz suchen, an dem sie vernünftig über die Dinge diskutieren können, die die LGBTG-Glaubensgemeinschaft des 21. Jahrhunderts im postmodernen, emergenten/Emerging Church Kontext anbelangen. Queermergent ist außerdem ein Raum für Leute, die selbst nicht zur LGBTQ-Gemeinschaft gehören, diese aber besser verstehen wollen … Queermergent versucht für ALLE Leute offen zu sein, auch für Heterosexuelle.
Hier geht es zur Internetseite: queermergent.wordpress.com.
Os Guinness kommentiert für die Zeitschrift USA Today die Amtseinführung von Barack Obama.
Hier der Kommentar: blogs.usatoday.com.
Mark Driscoll hat freundlicherweise Rick Warrens Gebet während der Amtseinführung von Barack Obama veröffentlicht und kurz kommentiert. Bei Youtube gibt es zudem einen Videomitschnitt.
 Ich gebe das Gebet hier in Amerikanisch wieder:
Ich gebe das Gebet hier in Amerikanisch wieder:
Almighty God, our Father:
Everything we see, and everything we can’t see, exists because of you alone.
It all comes from you, it all belongs to you, it all exists for your glory.History is your story.
The Scripture tells us, »Hear, O Israel, the LORD is our God, the LORD is one.« And you are the compassionate and merciful one. And you are loving to everyone you have made.
Now today, we rejoice not only in America’s peaceful transfer of power for the 44th time, we celebrate a hinge point of history with the inauguration of our first African-American president of the United States.
We are so grateful to live in this land, a land of unequaled possibility, where a son of an African immigrant can rise to the highest level of our leadership. And we know today that Dr. King and a great cloud of witnesses are shouting in heaven.
Give to our new president, Barack Obama, the wisdom to lead us with humility, the courage to lead us with integrity, the compassion to lead us with generosity.
Bless and protect him, his family, Vice President Biden, the Cabinet, and every one of our freely elected leaders.
Help us, O God, to remember that we are Americans—united not by race or religion or blood, but to our commitment to freedom and justice for all.
When we focus on ourselves, when we fight each other, when we forget you—forgive us.
When we presume that our greatness and our prosperity is ours alone—forgive us.
When we fail to treat our fellow human beings and all the earth with the respect that they deserve—forgive us.
And as we face these difficult days ahead, may we have a new birth of clarity in our aims, responsibility in our actions, humility in our approaches, and civility in our attitudes—even when we differ.
Help us to share, to serve, and to seek the common good of all.
May all people of good will today join together to work for a more just, a more healthy, and a more prosperous nation and a peaceful planet.
And may we never forget that one day, all nations–and all people–will stand accountable before you.
We now commit our new president and his wife, Michelle, and his daughters, Malia and Sasha, into your loving care.
I humbly ask this in the name of the one who changed my life—Yeshua, ‚Isa, Jesus [Spanish pronunciation], Jesus—who taught us to pray:
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name.
Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for Thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Amen.
 Die Katalogisierungssoftware Delicious Library 2 erlaubt Mac-Usern das schnelle Erfassen und Verwalten von Büchern, CDs oder DVDs. Anders als bei herkömmlichen Verwaltungsprogrammen müssen die Daten dabei nicht händisch eingegeben, sondern können über die Amazon-Datenbank eingespeist werden (sofern sie dort erfasst sind).
Die Katalogisierungssoftware Delicious Library 2 erlaubt Mac-Usern das schnelle Erfassen und Verwalten von Büchern, CDs oder DVDs. Anders als bei herkömmlichen Verwaltungsprogrammen müssen die Daten dabei nicht händisch eingegeben, sondern können über die Amazon-Datenbank eingespeist werden (sofern sie dort erfasst sind).
Obwohl Delicious Library keine echte Literaturverwaltung ist, lassen sich private Bibliotheken damit gut administrieren. Über eine Exportfunktion können die Daten zudem an andere Anwendungen (z.B. das wirklich gute Bookends) übergeben und dort weiterverarbeitet werden. Ich habe schon mit Hilfe verschiedener Anwendungen versucht, meine private Bibliothek zu erfassen. So weit wie mit Delicious Library 2 bin ich noch nie gekommen (ächz).
In einem kleinen Mitschnitt zeige ich hier, wie geschwind sich Bücher mit Delicious Library erfassen lassen, die einen Strichcode besitzen. Befindet sich auf einem Buch kein Strichcode, kann es über die ISBN-Nummer oder den Titel gesucht werden.
Eine Lizenz für die Datenbanksoftware kostet US$ 40. Ein exakt abgestimmter Bluetooth-Scanner kostet nochmals US$ 215. Allerdings lassen sich, wie im Screencast gezeigt, die Codes auch mit einer integrierten Kamera erfassen. Benötigt wird mindestens Mac OS X 10.5.
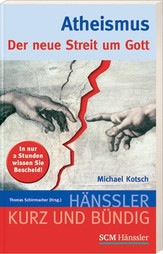 Nicht erst heute polarisiert die Frage nach Gott. Die Gottesfrage beschäftigt seit jeher die Menschen und beim gegenwärtigen ›Atheismuswahn‹ (A.E. McGrath) werden selten neue Argumente aktiviert, sondern schlicht längst überholte Positionen wiederholt.
Nicht erst heute polarisiert die Frage nach Gott. Die Gottesfrage beschäftigt seit jeher die Menschen und beim gegenwärtigen ›Atheismuswahn‹ (A.E. McGrath) werden selten neue Argumente aktiviert, sondern schlicht längst überholte Positionen wiederholt.
Michael Kotsch setzt sich in seinem Buch Der Atheismus kurz und bündig mit der Diskussion um Gott und den Atheismus auseinander. Die wichtigsten Argumente für und gegen Gott werde genannt und diskutiert.
Hier gibt es noch eine Leseprobe.
 Oliver Maksan geht in der Tagespost den Fragen nach, was George W. Bush glaubt und welchen Einfluss dieser Glaube auf seine Politik hatte. Das Ergebnis: Der Einfluss der Religion auf Bushs öffentliches Wirken wird weitgehend überschätzt. Seine Entscheidung zum Irakkrieg beispielsweise habe nichts mit einem Kreuzzug zu tun. Eher habe der Glaube für Bush während seiner Amtszeit eine persönlich stabilisierende Rolle gespielt. Er half dem scheidenden Präsidenten, »angesichts epochaler Herausforderungen schlicht die Nerven zu behalten«.
Oliver Maksan geht in der Tagespost den Fragen nach, was George W. Bush glaubt und welchen Einfluss dieser Glaube auf seine Politik hatte. Das Ergebnis: Der Einfluss der Religion auf Bushs öffentliches Wirken wird weitgehend überschätzt. Seine Entscheidung zum Irakkrieg beispielsweise habe nichts mit einem Kreuzzug zu tun. Eher habe der Glaube für Bush während seiner Amtszeit eine persönlich stabilisierende Rolle gespielt. Er half dem scheidenden Präsidenten, »angesichts epochaler Herausforderungen schlicht die Nerven zu behalten«.
Aber woran glaubt George Bush?
Als ein Reporter aus Houston ihn einmal fragte, warum er die Episkopal-Kirche seiner Kindheit gegen die Methodisten-Kirche ausgetauscht habe, antwortete er: »Ich bin mir sicher, dass es da große lehrmäßige Differenzen gibt. Aber ich bin nicht gebildet genug, um ihnen die erklären zu können.« Sein Biograf Jacob Weisberg hat da eine einfache Antwort: »Er versteckt seine religiösen Überzeugungen nicht. Er hat einfach nicht viele.« Weisberg glaubt, dass Bushs Glaube im Grunde vor allem einen Inhalt kennt: Therapie. »Self-help-Methodism« nennt er das, »Selbsthilfe-Methodismus«. Gott ist die starke Macht, die ihm half, seine Probleme mit dem Alkohol und mit sich selbst zu überwinden. Die ihm half, seine Ehe mit Laura zu retten und den überlegenen Vater zu ertragen. Bibel und Gebet als Therapie.
Eiferertum ist ihm fremd. So konnte er zum türkischen Premier Erdogan sagen: »Sie glauben an den Allmächtigen, und ich glaube an den Allmächtigen. Deswegen werden wir ausgezeichnete Partner sein.«
Übrigens untersuchte die Anglistin und Keltologin Lisanna Görtz für ihre Masterarbeit an der Universität Bonn 50 Radiobotschaften Bushs zum Irakkrieg und kam dabei zu dem Ergebnis, dass Bush weniger oft über Gott spricht als die meisten seiner Amtsvorgänger, und dass religiöse Anklänge bei ihm nur in Ansprachen zu christlichen Feiertagen, wie z.B. Ostern und Weihnachten, auftauchen.
Hier der Artikel von Oliver Maskan: www.die-tagespost.de.
Marius Reiser ist seit 1991 Professor für Neues Testament am Fachbereich Katholische Theologie der Universität Mainz. Zum Ende des laufenden Wintersemesters legt er diese Professur aus Widerstand gegen die unter dem Titel »Bologna-Prozess« betriebene und ihm als unerträglich erscheinende Hochschulreform nieder.
Reiser beklagt eine unerträglich Senkung des Ausbildungsniveaus:
Ich persönlich habe noch keinen Kollegen getroffen, der nicht das alte System für weit besser gehalten hätte als das neue. Das mag natürlich von Fach zu Fach etwas verschieden sein. Und natürlich hätte man an dem alten System das eine oder andere reformieren müssen. Aber das neue für insgesamt besser erklären? Unmöglich. Die meisten Kollegen sind sich einig, dass hier mit einem bedeutenden Mehraufwand an Lehre, Prüfungen und Verwaltungstätigkeit eine empfindliche Senkung des Niveaus erreicht wird und erreicht werden soll, faktisch eine Nivellierung von Universität und Fachhochschule. Und dennoch machen alle mit, nur die Juristen und Mediziner halten sich heraus und leisten zumindest hinhaltenden Widerstand.
Die FAZ hat die vollständige Begründung des Theologen abgedruckt: www.faz.net.
Wenn Sie ab und an ein hier vorgestelltes Buch über die angebotenen Verweise (engl. links) auf Amazon.de kaufen, erhalte ich als Partner von Amazon eine Werbekostenerstattung von 5 Prozent des Kaufpreises. Auf diese Weise können Sie den/das Blog unterstützen. Außerdem können Sie auf der Hauptseite über die Banner rechts unten Geschenkgutscheine oder sonstige Artikel bestellen. Über den Menüeintrag Buchladen erreichen Sie überdies den TheoBlog-Buchladen bei Amazon, indem wichtige und/oder gute (überwiegend) theologische Literatur empfohlen wird.
Wer keine Bücher bei Amazon bestellt, hat zudem die Möglichkeit, über Paypal zugunsten des Blogs zu spenden. Mehr dazu unter: Über TheoBlog.
Vielen Dank!
 Gary L.W. Johnson behauptet in seiner Einführung zu dem kürzlich vorgestellten Buch Reforming or Conforming? (Crossway, 2008, ›Introduction‹, S. 15–26), dass zahlreiche post-evangelikale Theologen den erfahrungstheologischen Ansatz Friedrich Schleiermachers aufgenommen haben.
Gary L.W. Johnson behauptet in seiner Einführung zu dem kürzlich vorgestellten Buch Reforming or Conforming? (Crossway, 2008, ›Introduction‹, S. 15–26), dass zahlreiche post-evangelikale Theologen den erfahrungstheologischen Ansatz Friedrich Schleiermachers aufgenommen haben.
Ich stimme dieser Analyse teilweise zu und stelle zum besseren Verständnis dieses Ansatzes hier einen Auszug aus der Vorlesung über »Apologetik« ein:
Friedrich Schleiermacher (1768–1834) lässt sich bei seinem Versuch, den christlichen Glauben erfahrungstheologisch zu begründen, von apologetischen Interessen leiten. Er stand vor der Aufgabe, nach der von Kant ausgelösten Wende das Christentum auf neue Weise zu begründen. Sein Ansatz wurde von zahlreichen liberalen Theologen, wie z.B. Ritschl (1822–1889), Harnack (1851–1930) oder Troeltsch (1865–1923) – mehr oder weniger – übernommen.
 Während offenbarungskritische oder konservative Theologen bisher gleichermaßen an der Vorstellung festhielten, der Glaube setze sich aus bestimmten Lehraussagen zusammen, knüpfte der späte Schleiermacher in seinem dogmatischen Hauptwerk Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (1. Aufl. 1821/22 u. 2. Aufl. 1830/31) an seine sprachlich besonders demonstrativ in der zweiten Auflage der Reden entwickelte Religionstheorie an. Demnach ist der Glaube wesentlich keine Sache des Verstandes, sondern des Gefühls.
Während offenbarungskritische oder konservative Theologen bisher gleichermaßen an der Vorstellung festhielten, der Glaube setze sich aus bestimmten Lehraussagen zusammen, knüpfte der späte Schleiermacher in seinem dogmatischen Hauptwerk Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt (1. Aufl. 1821/22 u. 2. Aufl. 1830/31) an seine sprachlich besonders demonstrativ in der zweiten Auflage der Reden entwickelte Religionstheorie an. Demnach ist der Glaube wesentlich keine Sache des Verstandes, sondern des Gefühls.
Für Schleiermacher steht das fromme Selbstbewusstsein des Menschen, jenes »Bewusstsein schlechthinniger Abhängigkeit« im Zentrum seiner Theologie. Die Glaubenslehre beruht nach Schleiermacher auf zweierlei, »einmal auf dem Bestreben die Erregung des christlich frommen Gemüthes in Lehre darzustellen, und dann auf dem Bestreben, was als Lehre ausgedrückt ist, in genauen Zusammenhang zu bringen«. An die Stelle der Heiligen Schrift tritt das Erleben des Gläubigen. »Der Mensch war das Subjekt seiner Theologie, Gott das Prädikat.« Jan Rohls schreibt dazu:
Gott ist uns also im Gefühl auf eine ursprüngliche Weise gegeben, so daß das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl nicht erst sekundär aus einem Wissen von Gott entsteht. Das Bewußtsein unserer selbst als in Beziehung zu Gott stehend ist daher ein unmittelbares Selbstbewußtsein, nämlich das Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit, das das sich selbst gleiche Wesen der Frömmigkeit ausmacht. Und Gott bedeutet zunächst nur dasjenige, was in diesem Gefühl als das mitbestimmende Woher unseres Soseins mitgesetzt ist.
Während bisher Frömmigkeit verstanden wurde als eine subjektive Reaktion auf objektive Lehrinhalte, dreht Schleiermacher die Ordnung um und setzt beim Gemüt an. Die Menschen verstehen die Welt, in der sie leben, durch den Einsatz ihrer Phantasie oder Intuition besser als durch Wissen. Die Glaubensdogmen sind nicht Ursprung, sondern Folge der Glaubenserfahrung. Sätze des Glaubens sind Ausdruck des frommen Gefühls.
Da sich das religiöse Bewusstsein in jedem Menschen findet, also auch bei Gläubigen anderer Religionen, findet man bei Schleiermacher die traditionelle Spannung zwischen dem Christentum und anderen Glaubenssystemen nicht mehr. Religionen werden also auf ihr Entwicklungsstadium befragt, da sie die notwendige Entfaltung des religiösen Bewusstseins spiegeln. Da alle drei monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam) derselben höchsten Entwicklungsstufe der Frömmigkeit angehören, können sie sich nur durch ihre Art der Frömmigkeit unterscheiden. Im Christentum kommt nach Schleiermacher die Frömmigkeit zu ihrer »reifsten Erfüllung«.
Auf diese Weise gelang Schleiermacher die intellektuelle Verteidigung des christlichen Glaubens in einem vom kantianischem Spinozismus geprägten Denkklima. Mit Karl Barth können wir sagen:
Das Christentum wird so interpretiert, daß es in dieser Interpretation, in dem als maßgebend vorausgesetzten Denken der Zeitgenossen ohne durch irgendwelche Kanten anzuecken, Raum bekommt. Ob die Leser diesen Raum beziehen, ob sie die ihnen vorgelegte anstoßfreie Darstellung des Christentums als ihren eigenen Gedanken nach- und mitdenken können und wollen, diese Frage bleibt natürlich offen. Aber das Christentum wird ihnen in einer solchen Gestalt bereitgestellt, daß ein grundsätzliches Hindernis gegen solches Beziehen dieses Raumes … nicht mehr bestehen kann.
Freilich war der Preis für diese »Anpassung« sehr hoch, denn seine evangelische Glaubenslehre war durch damals konsensfähige philosophische Voraussetzungen vereinnahmt worden. Schleiermacher hat – und auch hier können wir uns dem Verdacht des Schweizers Karl Barth anschließen, »die Umdeutung der Theologie in ein Stück allgemeiner Geisteswissenschaft vollzogen«. Schleiermacher verneint eine Autorität jenseits der Glaubenserfahrung, ob nun die der Heiligen Schrift oder die von Bekenntnissen. Zurecht hat er erkannt, dass bloßes intellektuelles Fürwahrhalten von Dogmen kein Glaube ist. Aber er ist so weit gegangen, dass er den Glauben auf die Subjektivität reduzierte.
– – –
Der Text kann (inklusive der Literaturangaben und Anmerkungen) hier als PDF-Datei herunter geladen werden: schleiermacher.pdf.