Letztlich ist Siegfried Zimmer – wie viele andere – auf der Suche nach einer metaphorischen oder symbolischen Wahrheit. Die Texte sind auf einen tieferen Sinn, auf einen allgegenwärtigen sensus plenior hin zu untersuchen. Wird die tiefere Wahrheit, also der Geist der Schrift im Gegensatz zu ihren bloßen Buchstaben, offengelegt, kann dies der Kirche geistliches Leben stiften.
Nun ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, in der Bibel nach mehr als nur nach historischen Wahrheiten zu suchen. Die Bibel enthält viele Erzählungen, Lieder, Gebete, Gleichnisse, Visionen usw. Das Ernstnehmen dieser Gattungen fördert zweifelsohne die ertragreiche Lektüre. Eine hervorstechende Leistung der vom Strukturalismus beflügelten Exegese ist es, Eigenarten von Textformen bis ins kleinste Detail zu beobachten und dadurch oft übersehene Feinheiten zutage zu fördern. Verfänglich wird es dann, wenn literarische Beobachtungen gegen die historische Verankerung von Erzählungen (so sie denn vorliegt) ausgespielt oder Denkfiguren einer doppelten Wahrheit eingeführt werden. Wir nehmen nach Zimmer die Bibel erst dann wirklich ernst, wenn wir (viele) ihrer Geschichten von ihrem Geschichtsbezug entbinden und symbolisch deuten. Der Graben zwischen der „Welt der Geschichte“ und der „Welt der Bibel“ bleibt also bestehen, ja es wird der Eindruck erweckt, Jesustreue ist daran abzulesen, dass dieser Graben akzeptiert wird. Auf der einen Seite haben wir die geschehene Offenbarung, auf der anderen die in der Heiligen Schrift aufgezeichneten Offenbarungszeugnisse.
Wir werden freilich mit den Schiffen oder Brücken der Symbolik, Allegorese oder Liturgie den garstigen Graben nicht queren. Wie soll aber Gott da noch klar reden? Führt das nicht zwangsläufig in die Unwirklichkeit Gottes? Ich finde es bemerkenswert, wie stark Zimmer die Verborgenheit Gottes herausstellt. Gottes „Wirken ist geheimnisvoll und unberechenbar“. Je „näher ich“ Gott „komme, desto geheimnisvoller wird er“. „Gott ist ein Geheimnis.“ „Auch in seiner Offenbarung bleibt Gott der verborgene Gott …“ „Wer sich dem verborgenen Gott anvertraut, wird erfahren, wie Gott durch die Bibel wirkt.“ „Es ist ein wichtiges Kriterium für die geistliche Qualität einer christlichen Gruppe, ob sie die Verborgenheit Gottes gebührend ernst nimmt, gerade auch in ihrem Verständnis der Bibel.“
Wie anders redet doch Paulus. Natürlich kennt auch er den unausforschlichen, verborgenen Gott (vgl. Röm 9, vgl. Jes 45,15). Doch weiß er, dass sich dieser unsichtbare Gott in seinen Werken allen Menschen so unzweideutig offenbart, dass sie keine Entschuldigung für ihren Undank haben (vgl. Röm 1,18–22). Vor allem aber hat Gott ihm und anderen Aposteln und Propheten durch den Geist das Geheimnis des Christus, welches früheren Generationen verborgen blieb, offenbart (vgl. Eph 3,3–9). Der Apostel ist eingesetzt, das Wort Gottes auszurichten, nämlich „das Geheimnis, das seit Urzeiten und Menschengedenken verborgen war – jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist“ (Kol 1,26). In Jesus, in dem gekreuzigten Christus, im Evangelium also, ist Gott offenbar und wird von den Seinen im Glauben erkannt. Der verborgene Wille Gottes – so hat Luther es einmal gesagt – ist „nicht zu erforschen“, sondern als ein Geheimnis „in Ehrfurcht anzubeten“. Erkannt und verkündigt wird Gott im Evangelium, bei dem allein wir Menschen Rettung und Trost finden (vgl. 1Kor 1,18–2,16). Jenen, die gerettet werden, ist dieses Evangelium Gottes Kraft und herrliche Freude (1Kor 1,18; 1Petr 1,8). „Was kann denn in der Schrift noch Erhabenes verborgen sein“ – schreibt Luther, „nachdem die Siegel gebrochen sind und der Stein von der Tür des Grabes weggewälzt worden ist? Womit das höchste Geheimnis an den Tag gekommen ist, dass nämlich Christus, der Sohn Gottes, Mensch geworden ist, dass Gott dreieinig ist und ein einziger, dass Christus für uns gelitten hat und in Ewigkeit herrschen wird.“ „Gott selbst wäre uns fern und verborgen, wenn uns Christus nicht mit seinem Glanz umstrahlte“, schreibt Calvin. Aber der „Vater hat alles, was er hatte, dem Eingeborenen gegeben, um sich uns in ihm zu offenbaren“. Deshalb ist in Christus „Gottes Herrlichkeit für uns sichtbar“.
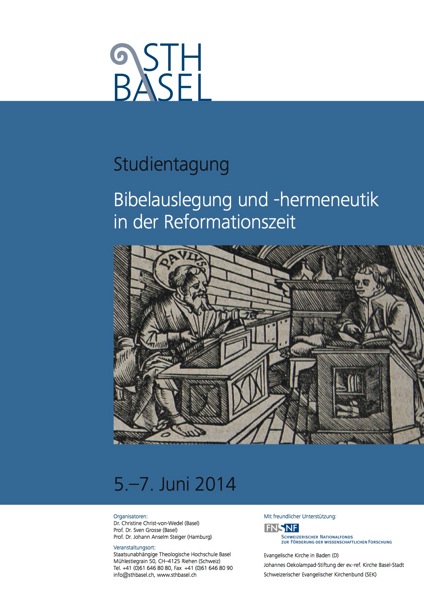 Im Jahr 2014 wird wieder eine reformationshistorische Tagung an der STH Basel stattfinden. Nach der Calvin-Tagung (2009) und der Tagung „Basel als Zentrum des geistigen Austausches in der frühen Reformationszeit“ (2012) wird es diesmal um das Thema „Bibelauslegung und -hermeneutik in der Reformationszeit“ gehen. Vorbereitet wird das Ereignis von Johann Anselm Steiger (Hamburg), Christine Christ-von Wedel (Basel) und Sven Grosse, mit Beratung durch Berndt Hamm (Erlangen/Ulm).
Im Jahr 2014 wird wieder eine reformationshistorische Tagung an der STH Basel stattfinden. Nach der Calvin-Tagung (2009) und der Tagung „Basel als Zentrum des geistigen Austausches in der frühen Reformationszeit“ (2012) wird es diesmal um das Thema „Bibelauslegung und -hermeneutik in der Reformationszeit“ gehen. Vorbereitet wird das Ereignis von Johann Anselm Steiger (Hamburg), Christine Christ-von Wedel (Basel) und Sven Grosse, mit Beratung durch Berndt Hamm (Erlangen/Ulm).