Ich lese derzeit eine umfangreiche Biographie über Wladimir Iljitsch Lenin. Das Buch wurde vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPDSU herausgegeben (Marxistische Blätter, Frankfurt a.M., 1976). Es strotzt vor Heldenverehrung. Am laufenden Band quäle ich mich durch Behauptungen wie: „Im Hause Uljanow herrschte stets Eintracht und Liebe“ (S. 20).
Eine ähnliche Heldenverehrung begegnet mir dieser Tage in der Berichterstattung über Nelson Mandela. Die Bewunderung für den „Held der Freiheit“ (Spiegel) erweckt fast den Eindruck, wir hätten es mit einem Messias zu tun. J.M. Coetzee spricht vom „letzten große Mann“.
Sogar christliche Agenturen überschlagen sich mit Komplimenten. „Nelson Mandela: ‚Gigant des 20. Jahrhunderts‘“, titelt beispielsweise das Medienmagazin pro. Bei Livenet.ch ist zu lesen: Zum Tod von Nelson Mandela: „Wir sind geboren, um Gottes Glanz zu zeigen“.
Auch wenn es pietätlos erscheinen mag: Mich ärgert diese naïve Medienhörigkeit ungemein.
Damit es keine Missverständnisse gibt: Natürlich war und ist die Rassentrennung ein Übel. Hoffentlich freuen wir uns darüber, dass Mandela in Südafrika zusammen mit vielen anderen auf ihre Überwindung hingewirkt hat und für Versöhnung eintrat. Müssen wir ihn deshalb wie einen Helden verehren? Er war kein Held, schon gar kein Held der Freiheit. Und so will ich hier auf einige Beiträge verweisen, die die Schattenseiten Mandelas erörtern:
1.) Mandelas ANC (African National Congress, gehört zur sozialistischen Internationale) war eine pro-sowjetische Partei. Sie unterstützte die sowjetische Invasion in Ungarn 1956 und die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei 1968.
2.) Nelson Mandela lobte persönlich die Diktaturen Libyen, Kuba, Palästina unter Arafat und die theokratische Diktatur des Iran. Nun möchte der Iran eine Straße nach Mandela benennen.
3.) 1962 wurde eine Schrift von Mandela namens „Wie man ein guter Kommunist ist“ gefunden, die auf dem stalinistischen Text „Wie man ein guter Kommunist ist“ (1939) von Liu Shaoqi (Staatschef unter Mao Zedong) beruht. Darin fordert er eine Orientierung an Lenin und Stalin.
4.) Nelson Mandela forderte 2002, dass sich alle Staaten dem Diktat der Vereinten Nationen beugen müssten. „Kein Land, egal wie friedlich es sein mag, hat das Recht, unabhängig von der UN zu handeln.“ Kein demokratisches Land soll also das Recht haben, irgendetwas zu tun, bevor es eine Bande von Gangstern, Mördern, islamistischen Klerikern, Anti-Semiten, Rassisten, kommunistischen Tyrannen und völkermordenden Diktatoren um Erlaubnis bittet.
Mehr ist hier zu finden: www.feuerbringer-magazin.de.
 Falls jemand auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk für einen Theologen oder Historiker ist, hier eine Empfehlung: Die Evangelische Verlagsanstalt gibt seit 2003 die Heubtartikel Christliche Lere in einer von Johannes Schilling, Ralf Jenett und anderen vorbildlich besorgten historisch-kritischen Ausgabe heraus.
Falls jemand auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk für einen Theologen oder Historiker ist, hier eine Empfehlung: Die Evangelische Verlagsanstalt gibt seit 2003 die Heubtartikel Christliche Lere in einer von Johannes Schilling, Ralf Jenett und anderen vorbildlich besorgten historisch-kritischen Ausgabe heraus. Vom 24.–26. April findet die mittlerweile 4. Evangelium21 Konferenz, wiederum in der Arche-Gemeinde in Hamburg statt. Das Konferenzthema lautet „Das Evangelium – das Wort der Wahrheit fürs ganze Leben“. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, dass das Evangelium eben nicht nur das Wort der Wahrheit ist, durch das Menschen zum Glauben kommen, sondern eine Botschaft, die alle Lebensbereiche verändert!
Vom 24.–26. April findet die mittlerweile 4. Evangelium21 Konferenz, wiederum in der Arche-Gemeinde in Hamburg statt. Das Konferenzthema lautet „Das Evangelium – das Wort der Wahrheit fürs ganze Leben“. Wir wollen gemeinsam darüber nachdenken, dass das Evangelium eben nicht nur das Wort der Wahrheit ist, durch das Menschen zum Glauben kommen, sondern eine Botschaft, die alle Lebensbereiche verändert!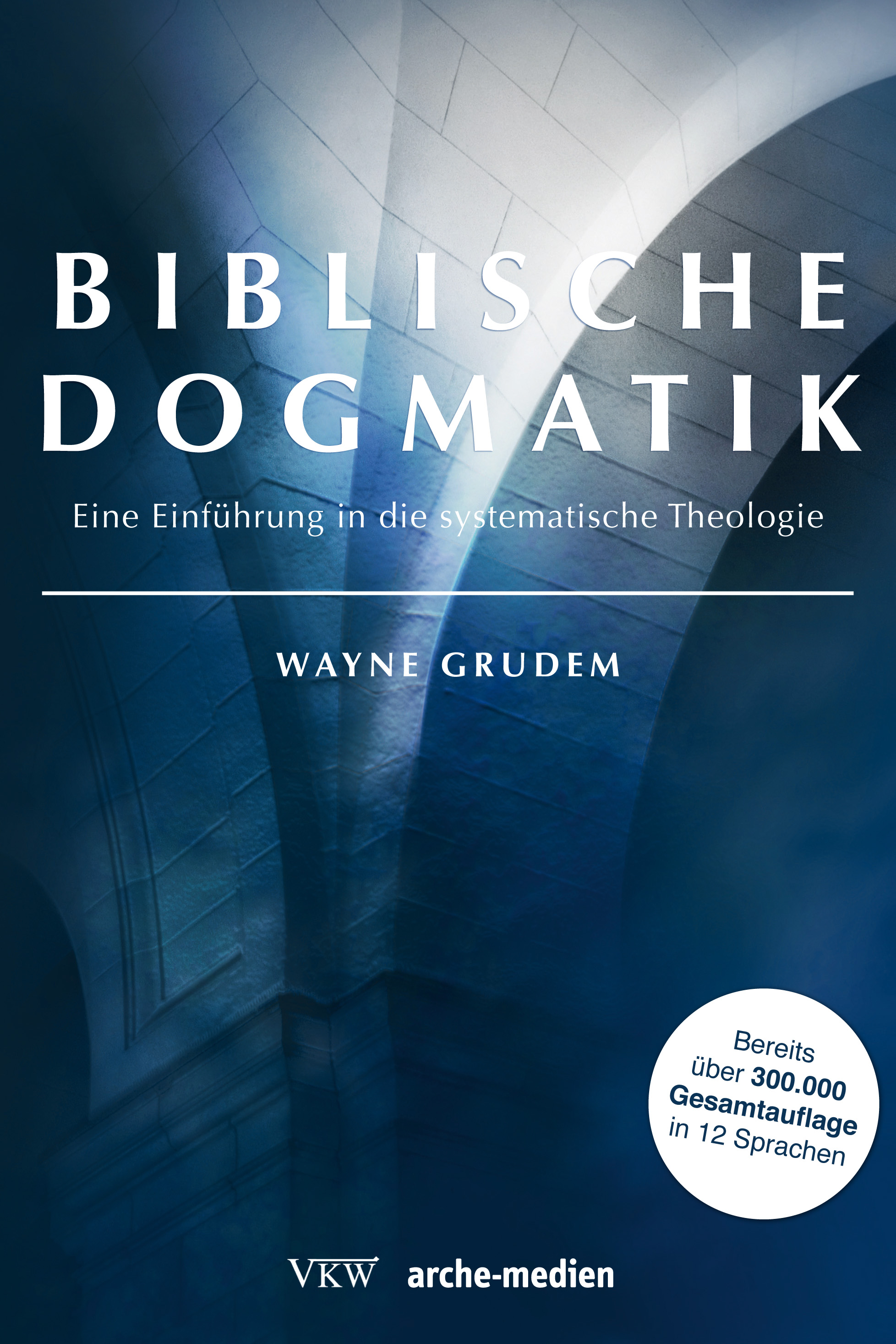

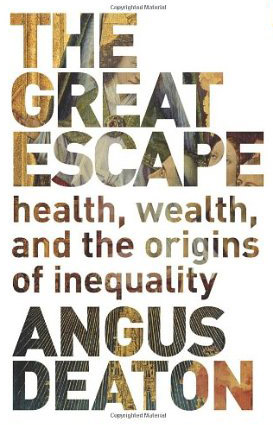 Brauchen die Ärmsten der Welt mehr Entwicklungshilfe? Nein, meint der Ökonom und Wachstumsforscher Angus Deaton in seinem neuesten Buch
Brauchen die Ärmsten der Welt mehr Entwicklungshilfe? Nein, meint der Ökonom und Wachstumsforscher Angus Deaton in seinem neuesten Buch