In dem Aufsatz „‚Genderismus‘ als Sündenbock“ beschwert sich Judith Butler über die zunehmende Kritik an den Gendertheorien (Philosophie Magazin, Sonderausgabe 20, Jan/Apr 2022, S. 18–23, zuerst am 23.10.2022 als „Why is the idea of ,gender‘ provoking backlash the world over?“ im Guardian erschienen).
Sie behauptet dort im Wesentlichen, dass der Treiber des „Antigenderismus“ die Sehnsucht nach autoritärer Herrschaft und Zensur sei. Unter dem Vorwand, dass die Kritiker der Gendertheorien keinen Bildungswillen mitbrächten und kaum dazu bereit seien, sich mit Ansichten auseinanderzusetzen, die ihren eigenen widersprechen, verzichtet sie darauf, inhaltliche Argumente für ihre Behauptung vorzutragen. Dafür macht sie genau das, was sie ihren Opponenten unterstellt. Sie vereinfacht, diffamiert und schablonisiert. Und sie rückt den „Antigenderismus“ in die Nähe des Faschismus. Ausgrenzungen dieser Art verfehlen ihr Ziel selten. Sie zeigen eben auch oft, dass es um sachliche Argumente nicht gut bestellt ist.
Nachfolgend einige Zitate von Judith Butler aus dem besagten Aufsatz:
Die Argumente der Anti-Gender-Bewegung sperren sich gegen eine schlüssige Rekonstruktion, weil es ihren Vertretern nicht unbedingt auf Konsistenz und Kohärenz ankommt. (S. 19)
Auch wenn die Bewegung allgemeiner nationalistisch, transphob, misogyn und homophob ist, besteht ihr Hauptziel in einer Umkehrung der rechtlichen Fortschritte, die die LGBTQI- und feministischen Bewegungen in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben. (S. 19)
[Die Vertreter der Gendertheorien] bestreiten nicht, dass es ein biologisches Geschlecht gibt; sie fragen danach, wie Geschlecht durch medizinische und rechtliche Rahmenbedingungen hergestellt wird, wie sich dieser Rahmen historisch verändert hat und welchen Unterschied es für die soziale Organisation unserer Welt macht, wenn das Geschlecht, das wir bei der Geburt zugewiesen bekommen, für das weitere Leben unter anderem in den Arbeits- und Liebesverhältnissen keine vorbestimmende Rolle mehr spielt. (S. 19–20)
Im Allgemeinen stellen wir uns die Zuweisung des Geschlechts als etwas vor, das nur einmal geschieht. Aber was ist, wenn wir es uns als komplexen und revidierbaren Prozess denken? Das heißt über die Zeit revidierbar für diejenigen, die das falsche Geschlecht zugewiesen bekommen haben? Wer eine solche Perspektive einnimmt, stellt sich nicht gegen die Wissenschaft, sondern fragt nur, in welcher Weise Wissenschaft und Recht in die soziale Regulierung von Identitäten eingehen. (S. 20)
Angestachelt von Sorgen vor einem Zusammenbruch der Infrastruktur, Hass auf Migranten und – in Europa – der Furcht, der Unantastbarkeit von heteronormativer Familie, nationaler Identität und weißer Vorherrschaft verlustig zu gehen, suchen viele die Schuld bei der zersetzenden Kraft von Gender, Postkolonialismus und Critical Race Theory. Wenn sich diese Gruppen Gender als Invasion von außen imaginieren, zeigen sie nur zu deutlich, dass sie selbst nationalistisch motiviert sind. (S. 20)
Gleichzeitig nehmen Gegner der „Gender-Ideologie“ Zuflucht zur Bibel, um ihre Ansichten über die natürliche Hierarchie zwischen Mann und Frau und über die je eigenen Vorzüge des Männlichen und Weiblichen zu untermauern (auch wenn fortschrittliche Theologen klargestellt haben, dass diese auf strittigen Lesarten der Bibeltexte beruhen). In Angleichung der Bibel an die Naturrechtslehre erklären sie das zugewiesene Geschlecht zur göttlichen Setzung und tun seltsamerweise so, als stünden heutige Biologinnen und Medizinerinnen im Dienste einer Theologie aus dem 13. Jahrhundert. (S. 22)
Als faschistische Tendenz greift sie vielmehr auf eine ganze Reihe rhetorischer Strategien aus dem gesamten politischen Spektrum zurück, um damit die Angst vor Unterwanderung und Zerstörung, die ganz unterschiedlichen ökonomischen und sozialen Kräften entspringt, auf die Spitze zu treiben. Sie strebt überhaupt nicht nach Konsistenz, denn ihre Stärke speist sich gerade auch aus ihrer Inkohärenz. (S. 22)
[Die Anti-Gender-Ideologie] ist reaktionäre Hetze, ein Bündel aufwiegelnder Widersprüche und inkohärenter Behauptungen und Anwürfe. Sie lebt von genau der Instabilität, die sie einzudämmen verspricht, und ihr eigener Diskurs stiftet selbst nichts als Chaos. Durch eine Flut inkonsistenter und übertreibender Behauptungen rührt sie sich eine Welt diverser unmittelbarer Bedrohungen zusammen, um ihren Ruf nach autoritärer Herrschaft und Zensur zu unterfüttern.
Als faschistische Tendenz unterstützt die Anti-Gender-Bewegung immer stärker werdende Formen des Autoritarismus. Durch ihre Taktiken werden Staaten ermutigt, in Universitätsprogramme einzugreifen, Kunst und TV-Programme zu zensieren, Transpersonen ihre Rechte zu verwehren und LGBTQI aus öffentlichen Räumen zu verbannen, reproduktive Freiheiten einzuschränken und den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, Kinder und LGBTQI- Personen zu untergraben. (S. 23)
Warum ist dieser Beitrag so unsachlich und im Ton herabwürdigend? Zum Teil kann das damit erklärt werden, dass viele Texte von Judith Butler in so einem Stil vorgetragen sind. Sie schreibt mehr als Aktivistin denn als Philosophin. Es könnte aber darüber hinaus der Fall sein, dass sich immer mehr Intellektuelle gegen die oft seltsamen Thesen des Genderaktivismus wehren und die Luft für die vielen Gender-Professorinnen enger wird. Aus Betroffenheit entwickelt sich manchmal Wut.
Alan Sokal (ja, genau der vom Sokal-Skandal, vgl. hier S. 11–16) kommentiert den Aufsatz von Butler sachlich: „Wir unterstützen voll und ganz das Recht aller Menschen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wünschen, frei von Gewalt, Belästigung und Diskriminierung. Wir sind jedoch nicht mit der radikalen Idee einverstanden, dass die selbst deklarierte Geschlechtsidentität das biologische Geschlecht für alle rechtlichen und sozialen Zwecke ersetzen sollte.“
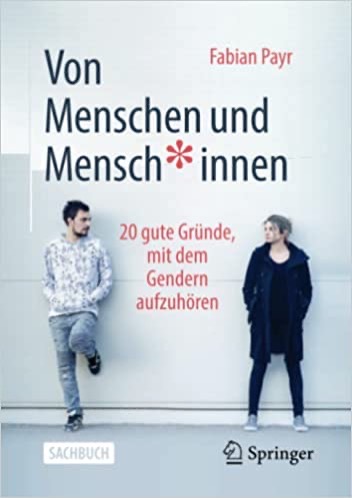 Die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache hat das Potential, die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Einerseits wird das Gendern von öffentlichen Behörden, Universitäten und bei manchen Medien „verordnet“, andererseits empfinden immer mehr Menschen diese verordneten Eingriffe in die Sprache als Bevormundung. Die Progressiven machen freilich einfach weiter und gehen davon aus, dass sich die Mehrheit an die neue Sprache gewöhnen wird. Nur dann, wenn die Sprache verändert werde, könnten patriarchische Strukturen durchbrochen und Frauen endlich sichtbar gemacht werden, meinen sie.
Die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache hat das Potential, die Gesellschaft noch weiter zu spalten. Einerseits wird das Gendern von öffentlichen Behörden, Universitäten und bei manchen Medien „verordnet“, andererseits empfinden immer mehr Menschen diese verordneten Eingriffe in die Sprache als Bevormundung. Die Progressiven machen freilich einfach weiter und gehen davon aus, dass sich die Mehrheit an die neue Sprache gewöhnen wird. Nur dann, wenn die Sprache verändert werde, könnten patriarchische Strukturen durchbrochen und Frauen endlich sichtbar gemacht werden, meinen sie.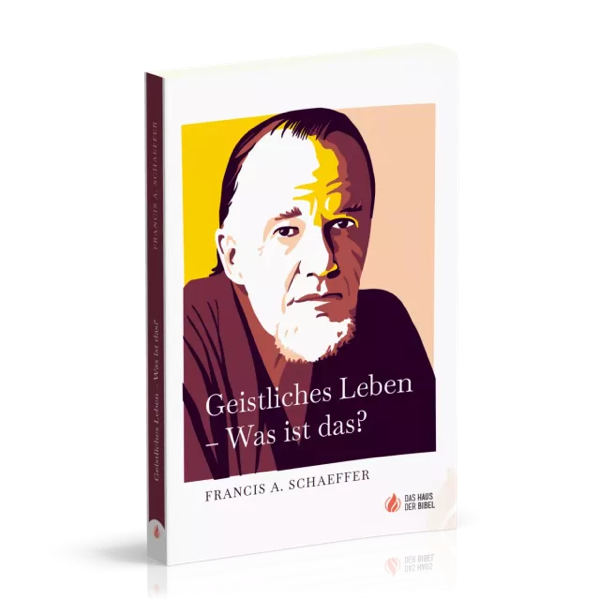 Das Haus der Bibel hat einige Bücher von Francis Schaeffer neu aufgelegt, darunter
Das Haus der Bibel hat einige Bücher von Francis Schaeffer neu aufgelegt, darunter 
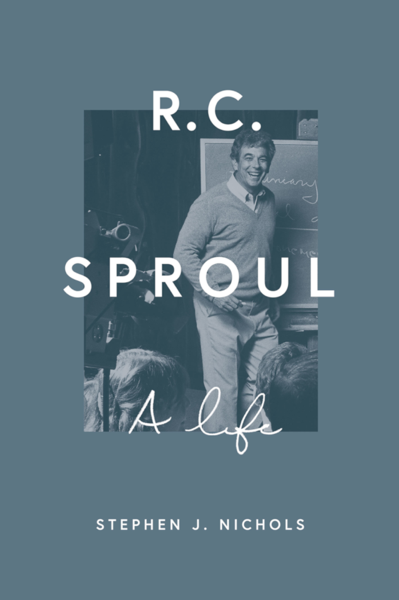 Am 14. Dezember 2017 verstarb R.C. Sproul im Alter von 78 Jahren. Timon Kubsch hat anlässlich seines Todestages die Biographie
Am 14. Dezember 2017 verstarb R.C. Sproul im Alter von 78 Jahren. Timon Kubsch hat anlässlich seines Todestages die Biographie