Vor einigen Wochen habe ich mit Benjamin Schmidt und Andreas München über die Herold-Mission gesprochen. Das Gespräch, in dem es auch im die Theologie von Charles Finney geht, kann hier gehört werden: www.evangelium21.net.
Glauben und Denken heute 2/2021
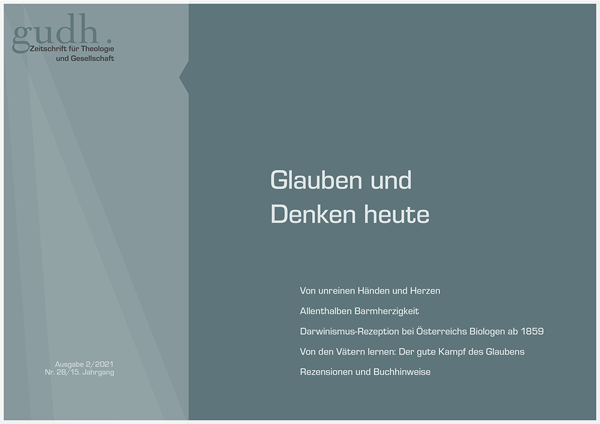 Die Ausgabe Nr. 28 (2/2021) der Zeitschrift für Theologie und Gesellschaft Glauben und Denken heute ist erschienen. Diese Ausgabe enthält wieder eine Reihe interessanter Beiträge. David Gibson erörtert in seinem Aufsatz Calvins Erwählungslehre, über die übrigens in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel geschrieben wurde, wie manche denken. Markus Till setzte sich in seinem Aufsatz mit der Kanonkritik von Thorsten Dietz auseinander. Es folgen kürzere Artikel von Thomas Schirrmacher, Franz Graf-Stuhlhofer, Hartmut Steeb und Dirk Störmer. Ergänzt wird die Ausgabe abermals durch mehrere Rezensionen und Buchhinweise.
Die Ausgabe Nr. 28 (2/2021) der Zeitschrift für Theologie und Gesellschaft Glauben und Denken heute ist erschienen. Diese Ausgabe enthält wieder eine Reihe interessanter Beiträge. David Gibson erörtert in seinem Aufsatz Calvins Erwählungslehre, über die übrigens in den letzten Jahrzehnten gar nicht so viel geschrieben wurde, wie manche denken. Markus Till setzte sich in seinem Aufsatz mit der Kanonkritik von Thorsten Dietz auseinander. Es folgen kürzere Artikel von Thomas Schirrmacher, Franz Graf-Stuhlhofer, Hartmut Steeb und Dirk Störmer. Ergänzt wird die Ausgabe abermals durch mehrere Rezensionen und Buchhinweise.
Artikel:
- Editorial: Von unreinen Händen und Herzen (Hanniel Strebel)
- Entstehung und Autorität des neutestamentlichen Kanons (Markus Till)
- Allenthalben Barmherzigkeit (David Gibson)
- „Untertan der Obrigkeit“ (Hartmut Steeb)
- Der Rat, den mir Billy Graham gab (Thomas Schirrmacher)
- Quellen zur Blasphemie aus drei Kirchengeschichtsepochen (Dirk Störmer)
- Darwinismus-Rezeption bei Österreichs Biologen ab 1859 (Franz Graf-Stuhlhofer)
- Der gute Kampf des Glaubens (J. Gresham Machen)
Rezensionen:
- Alisa Childers: Ankern (Tanja Bittner)
- Markus Spieker: Jesus: Eine Weltgeschichte (Franz Graf-Stuhlhofer)
- David Gooding, John Lennox: Was sollen wir tun? Was ist das beste Konzept für Ethik? (Daniel Facius)
- Peter Heinrich: Mensch und freier Wille bei Luther und Erasmus (Ron Kubsch)
- Reinhard Junker: Schöpfung oder Evolution. Ein klarer Fall!? (Franz Graf-Stuhlhofer)
- Hoon J. Lee: The Biblical Accommodation Debate in Germany (Luke Stannard)
- Manuel Schmid: Kämpfen um den Gott der Bibel (Martin Schönewerk)
- Stefan Wenger: Reise durch das Alte Testament: Eine theologische Bibelkunde (Tanja Bittner)
Buchhinweise:
- Matthias Schleiff: Schöpfung, Zufall oder viele Universen? (Franz Graf-Stuhlhofer)
- Bernhard Meuser: Freie Liebe: Über neue Sexualmoral (Michael Freiburghaus)
- Peter H. Uhlmann: Das Christentum in der Antike (Daniel Facius)
Die Ausgabe kann hier heruntergeladen werden: GuDh_2_2021.pdf.
Eine Feministin findet zu Christus
In ihrem Buch Offene Türen öffnen Herzen: Radikal einfache Gastfreundschaft in einer nachchristlichen Welt berichtet die ehemalige Feministin, wie sie von Gott gefunden wurde. Wie hörte sie vom Evangelium? Gott benutzte eine Einladung zum Abendessen in einem einfachen Haus, von einem bescheidenen Ehepaar ausgesprochen. Auf dem Hintergrund ihrer eigenen Bekehrung lädt uns Rosaria Butterfield in ihr Haus ein, um uns zu zeigen, wie Gott dieselbe „radikal normale Gastfreundschaft“ gebrauchen kann, um unseren verlorenen Freunden und Nachbarn das Evangelium zu bringen Sie eröffnet einen neuen Blick: Unsere Häuser gehören nicht uns allein, sondern sind Gottes Werkzeuge zum Bau seines Reiches Einfach dadurch, dass wir solche, die anders denken und leben als wir, in unserem alltäglichen, manchmal chaotischen Leben willkommen heißen – und ihnen so zu sehen helfen, was wahrer christlicher Glaube ist.
Bei Evangelium21 ist ein Auszug aus dem Buch zu finden. Darin wird deutlich, dass sogar die „Hausmusik“ eine Rolle gespielt hat:
Im Haus der Smiths leitete Pastor Ken etwas, das sie als „Hausandacht“ bezeichneten. Dabei gingen sie den Jakobusbrief durch. Ich war fasziniert. Jakobus war ein schrecklich praktisches Buch, dachte ich. Und es war faszinierend in seiner Einfachheit.
Jakobus enthielt für mich außerdem ein paar geistreiche Spitzen. Tratsch, die Zunge als Brandstifter, Schimpfwörter.
Was sollte ich mit meinen Kollegen reden, wenn wir nicht über andere Kollegen tratschen konnten?
Wie konnte ich einen Satz ohne ein Schimpfwort beenden? Aber der beste Teil des Abends war der Gesang.
Musikalisch gebildete Menschen sind schwer zu finden. Ich freute mich wahnsinnig, dass ich welche gefunden hatte. In meiner Alltagswelt hatten wir einen schwulen Männerchor – und die Leute da waren sehr, sehr gut. Aber irgendwie interessierten sich die Lesben in meinem Kreis nicht dafür. Und so war ich in meiner LGBTQ-Gemeinschaft auf einen Platz im Publikum verwiesen. Die Psalmen in vierstimmiger Harmonie zu singen war auf eine neue Art sinnlich für mich.
Ich übte sogar zu Hause und wärmte meine Stimme für unser „Psalmensingen“ auf. Einmal, als ich gerade Tonleitern als stimmliche Aufwärmübung für den Psalmengesang sang, schaute meine Partnerin mich mit hochgezogener Augenbraue an:
„Was genau macht ihr da in dem Sektenhaus?“
So nannten wir Ken und Floys Haus: das „Sektenhaus“.
Ich verachtete sie. Ich verspottete sie. Ich machte mich über unser Bibellesen und unseren Psalmengesang lustig. Und sie liebten mich. Sie bezogen mich ein und beteten für mich.
Mehr: www.evangelium21.net.
Alles Einstellungssache
Alles eine Sache der Perspektive, meinen die Postmodernen. Bei der Abtreibungsfrage klingt das dann so (FAS vom 14.11.2021, Nr. 45, S. 15): Die Zeichnerin Julia Zejn zeigt Schwangerschaftsabbrüche so, wie viele Frauen sie empfinden: Als Entscheidung, die nicht leichtfertig getroffen wird, aber mit der sie im Reinen sind. Ich zitiere:
„Ihre Protagonistin sagt bei der Beratung, sie habe kein schlechtes Gewissen dem Embryo gegenüber. War das bei Ihnen auch so?
Ja. Ich habe das nicht als Wesen gesehen, sondern als ungewollte Schwangerschaft. Wenn man gewollt schwanger ist, hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Gerade am Anfang einer Schwangerschaft sind Muttergefühle eine Einstellungssache.“
Jetzt stellen wir uns mal vor, wir reden mit einem, der eine Tankstelle brutal überfallen hat. Das geht dann so:
Haben Sie ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Tankstellenwärter, den sie ermordet haben?
Ich habe den Tankstellenwart nicht als menschliches Wesen gesehen, sondern als ein Ereignis, das in meine aktuelle Lebenssituation und meine Pläne nicht hineinpasst. Das ist letztlich eine Einstellungssache.
Was hält jemanden in Deutschland davon ab, Christ zu werden?
Vor einigen Wochen hat mich Christoph Koehler interviewt. Hier ein Auszug:
Christoph: Menschlich gesehen, was hält jemanden in Deutschland davon ab, Christ zu werden? Welche Hürden stehen einem da entgegen?
Ron: Wie ich gerade sagte, erwarten viele Deutsche nichts von Gott. Sie wollen selbst darüber entscheiden, worum es im Leben geht. Luther sagte einmal: Die Menschen wollen nicht, dass Gott Gott ist. Ich denke, es beschreibt alle Menschen, aber unsere Generation vielleicht besonders treffend. Die Leute wollen nicht, dass da jemand ist, der ihnen etwas vorschreibt und sagt, wo es lang geht. Es geht ihnen so gut, dass sie auch ohne Gott zurechtkommen. Die Trauerarbeit ist abgeschlossen. Die Menschen vermissen Gott nicht.
Christoph: Was kümmert Christen in Deutschland? Worüber denken sie? Was ist ihnen wichtig?
Ron: Ich glaube, wir haben vergessen, dass Gott heilig ist. Das scheint mir ein großes Problem zu sein. So verbringen viele Christen ihre Zeit mit dem Entertainment oder mit der Selbstoptimierung. Gottesdienste sind dann schön, wenn sich Menschen wohlfühlen. Der Glaube wird als ein attraktives Angebot vermittelt. Er wird in einer Weise verkündigt, dass er keinen Anstoß mehr weckt. Ich glaube, Jesus war da ganz anders unterwegs. Denken wir nur an Luk 9,23–24: „Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten.“ Wenn wir das Gesetz, also den Anspruch Gottes nicht verkündigen, werden wir auch nicht verstehen, was das Gute an der Guten Nachricht ist.
Mehr: appliedtheology.net.
Gewissensvorbehalt gestrichen
Was soll man von einer Kirche halten, die ihren Pastoren verbietet, gleichgeschlechtliche Paare nicht zu segnen oder zu trauen? Kann ein Segen erzwungen werden? Haben nicht gerade die Protestanten die Freiheit des Gewissens einmal lautstark verteidigt?
Die Nachrichtenagentur idea schreibt:
Die Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) hat eine Änderung im Partnerschaftsgleichstellungsgesetz beschlossen. Danach wird Paragraf 5 des Gesetzes gestrichen. Dieser ermöglichte es Pfarrern, die eine Trauung oder Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren nicht mit ihrem theologischen Gewissen vereinbaren konnten, eine solche Handlung abzulehnen.
„Mit der Streichung von Paragraf 5 entscheiden wir uns für eine Kirche der Vielfalt“, erklärte das Mitglied der Kirchenleitung, Ingrid Höfner-Leipner (Cottbus). Mit diesem Schritt wolle die Landeskirche Diskriminierung entgegenwirken.
Dass derzeit keine dienstrechtlichen Sanktionen bei Verstoß vorgesehen sind, kann da auch nicht trösten.
Die „Woke-Culture“ und die Evangelikalen
Markus Till hat auf seinem Blog den Artikel „The Failure of Evangelical Elites“ (erschienen bei First Things) von Carl Trueman zusammengefasst. Trueman fragt unter anderem, warum es trotz der Arbeiten von Mark Noll und George Marsden den Evangelikalen nicht gelungen ist, in der akademischen Welt Fuß zu fassen (siehe zu Noll und Marsden auch das Interview hier). Nach Trueman liegt es nicht an mangelhaften akademischen Fähigkeiten oder an den schlechten Argumenten. Vielmehr macht er die „Woke-Kultur“ an den Hochschulen für diese Entwicklung verantwortlich. „Woke“ bezeichnet eine Haltung, die „aufgeweckt“ nach fehlender sozialer Gerechtigkeit, Rassismus oder Ungleichbehandlung Ausschau hält und diese Dinge aktionistisch anprangert. Die „Woke-Kultur“ trägt mit dazu bei, dass nur noch bestimmte Meinungen als diskursfähig gelten. Theorien oder Überzeugungen, die dem „Mainstream“ nicht entsprechen, sollen am Besten gar nicht mehr zu Wort kommen (hier liegen die Schnittstellen zur Abbruchs-Kultur (engl. Cancel Culture). Die christlichen Wissenschaftlicher werden nach Trueman also gemieden, weil man ihren Glauben und ihre Ethik für ethisch verwerflich hält.
Markus Till schreibt:
Die Thesen von Noll und Marsden schienen anfangs gute Früchte zu tragen. Ihre Doktoranden erhielten Stellen an Hochschulen und Universitäten. Als Musterbeispiel diente viele Jahre der von Obama eingesetzte evangelikal geprägte Leiter des Nationalen Gesundheitsinstituts Francis Collins. Gerade an seinem Beispiel macht Trueman jedoch deutlich, wie schwer es offenkundig ist, als evangelikaler Christ in solche Positionen aufzusteigen, ohne seine christlichen Werte zu kompromittieren. Collins ist dies offenbar nicht gelungen. Und Trueman stellt fest, dass es heutzutage kaum noch möglich ist, konfliktfrei an wichtigen christlichen Überzeugungen innerhalb der intellektuellen Eliten festzuhalten:
„Obwohl Marsden und Noll ihre Argumente vor weniger als dreißig Jahren vorbrachten, fällt mir auf, dass ihre Argumente aus einer längst vergangenen Zeit stammen. Die Vorstellung, dass eine Person, die sich zu Ehrlichkeit und Integrität in der Wissenschaft bekennt, Mitglied der heutigen Universitäten und anderer führender Institutionen werden kann, ist rückblickend betrachtet naiv. … Letztes Jahr habe ich am Grove City College einen Kurs über historische Methoden gehalten. Einer unserer Texte war Marsdens ‘The Outrageous Idea of Christian Scholarship’. Die Reaktion der Studenten auf das Buch war beeindruckend. Obwohl sie Marsden für einen nachdenklichen und engagierten Autor hielten, waren sie der Meinung, dass sein Argument – dass Christen einen Platz am Tisch der akademischen Welt finden könnten, wenn sie gute Gelehrte seien und ihre Kollegen mit Respekt behandelten – im heutigen Kontext nicht überzeugend ist. Kein Student glaubt heute, dass ein Professor einer Forschungsuniversität, der höflich und respektvoll zu einem schwulen Kollegen ist, auch seine Einwände gegen die Homo-Ehe äußern darf. So funktioniert das System nicht mehr.“
Aber warum ist das so? Trueman legt dar, dass die führenden Evangelikalen in ihrem Versuch, das Christentum in den intellektuellen Eliten gesellschaftsfähig zu machen, einen entscheidenden Punkt übersehen haben, der in den letzten 30 Jahren immer deutlicher zutage getreten ist:
„Das Hochschulwesen ist heute weitgehend das Land der „Woken“. Man mag ein brillanter Biochemiker sein oder ein profundes Wissen über die minoische Zivilisation haben, aber jedes Abweichen von der kulturellen Orthodoxie in Bezug auf Rasse, Sexualität oder sogar bei anderen Begriffen wird sich bei Einstellungs- und Bleibeverhandlungen als wichtiger erweisen als Fragen nach der wissenschaftlichen Kompetenz und sorgfältiger Forschung. … Meine Studenten können die Realität sehr genau einschätzen. Die kultivierten Verächter des Christentums von heute halten dessen Lehren nicht für intellektuell unplausibel, sondern für moralisch verwerflich. Und das war schon immer zumindest teilweise der Fall. Das war der Punkt, den Noll und Marsden übersehen haben – auch wenn er in den neunziger Jahren am Wheaton College oder an der Universität von Notre Dame vielleicht nicht so offensichtlich war wie heute fast überall im Hochschulbereich.”
Wie man einen Personenkult erkennt
Für Martin Luther ist Ruhmsucht eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Wer den eigenen Namen groß macht, entehrt laut dem Reformator den Namen Gottes. Er schreibt (Von den Guten Werken, 1520, in: J. Schilling, A. Beutel, D. Korsch, N. Slenczka, & H. Zschoch (Hrsg.), Martin Luther: Glaube und Leben: Heutiges Deutsch, Bd. 1, S. 141):
Auf diese Weise wird durch unseren verfluchten großen Namen, unsere Selbstgefälligkeit und Ehrsucht der heilige Name Gottes unnütz gebraucht und entehrt, der doch allein geehrt werden sollte. Diese Sünde wiegt vor Gott schwerer als Totschlag und Ehebruch, aber wegen ihrer Subtilität sieht man ihre Bosheit nicht so klar wie die des Totschlags, denn sie wird nicht offensichtlich und äußerlich, sondern im Geist vollbracht.
Trotzdem oder vielleicht genau deshalb gib es so etwas wie einen frommen Personenkult, auch in rechtgläubigen Kreisen. Die digitalen und sozialen Medien begünstigen narzistische Ambitionen. Mark Hampton hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Wenn Verkündiger im Vordergrund stehen, wird eben keine christozentrische Gemeindekultur gefördert. Vielmehr binden narzistische Leiterpersönlichkeiten Menschen an sich selbst. Sie suchen Aufmerksamkeit und Bewunderung. Hampton zählt einige Merkmale des Personenkults auf:
- Schamlose Eigenwerbung: Dies ist vielleicht das verräterischste Zeichen eines Personenkults und in der Regel auch am leichtesten zu erkennen. Schauen Sie sich die sozialen Medien oder die Webseite der Persönlichkeit oder der Gemeinde an. Gibt es dort viele Fotos von der Person auf der Bühne und vor großen Menschenmengen? Personenkulte zwingen Ihre Aufmerksamkeit auf eine einzige Person, und die kommt nicht aus Nazareth. Personenkulte bieten Ihnen viele Möglichkeiten, Abonnent, Anhänger oder Kunde zu werden. Oft handelt es sich dabei nicht um Evangelisation oder Jüngerschaft, sondern um Werbung.
- Zahlen sind das Wichtigste: Die Zahl der Anhänger oder die Höhe des eingesammelten Geldes sorgt regelmäßig für Aufmerksamkeit und rechtfertigt die Arbeit der Persönlichkeit. So viele Menschen können sich nicht irren, könnte man meinen.
- Abdrängung von Andersdenkenden: Wenn diejenigen, die Fragen oder Bedenken äußern, zum Schweigen gebracht oder an den Rand gedrängt werden, haben Sie es möglicherweise mit einem Personenkult zu tun. Personenkulte scharen sich um eine einzige Person. Jeder, der nicht an Bord ist, der etwas in Frage stellt, nicht zustimmt oder abweicht, wird in der Regel hinausgedrängt.
Mehr hier: www.thegospelcoalition.org.
Baden-Württemberg gendert
Die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten empfiehlt den Hochschulen in Baden-Württemberg die Nutzung der Gendersprache. Die Nachrichtenagentur idea meldet:
Verwendet werden solle dabei wahlweise der Genderstern, ein Doppelpunkt oder ein Unterstrich. Durch die Nutzung dieser Sonderzeichen sollen laut der Empfehlung „beim Schreiben und Lesen alle Geschlechter erfasst und sichtbar gemacht werden. In der gesprochenen Sprache kann dies durch eine Pause im Wort erzielt werden.“ Dabei gehe es vor allem um die Vermeidung des generischen Maskulinums. Das könne man auch durch geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen wie „Beschäftigte“ oder die Substantivierung von Partizipien wie bei dem Wort „Studierende“ erreichen.
Es ist schon erstaunlich, wie Ideologen die Neuformatierung der Sprache vorantreiben. Der Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Baden-Württemberg kritisiert die neuen Leitlinien. Der größte und älteste Studentenverband Deutschlands hat sich schon mehrfach dagegen ausgesprochen, die Genderideologie an den Hochschulen durch Zwang zu etablieren. Der Verband wendet sich gegen die Verpflichtung der Gendersprache in Bildungseinrichtungen, der Verwaltung und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Falsche Geistlichkeit
Screwtape erteilt dem Unterteufel Wormwood in den Dienstanweisungen für einen Unterteufel den aufschlussreichen Rat (Brief XXVII):
Falsche Geistlichkeit ist stets zu fördern.
„Unterordnen“ – Dimensionen eines anstößigen Begriffs
Es fällt uns heute schwer, dass „sich unterordnen“ semantisch anerkennend zu besetzen. Wir leben in einer Kultur, in der Unterordnung überwiegend mit Nachteilen verknüpft und deshalb vermieden wird. Heute wollen wir leiten, nicht dienen. Dabei finden wir in der Heiligen Schrift durchaus viele Aufforderungen, uns unterzuordnen. So heißt es etwa in Tit 3,1: „Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind.“ Und woanders steht auch noch: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich´s gebührt im Herrn!“ (Kol 3,18).
Tanja Bittner ist in ihrem Artikel „‚Unterordnen‘ – Dimensionen eines anstößigen Begriffs“ mal der Frage nachgegangen, wie Christen diese einschlägigen Unterordnungstexte zu verstehen haben:
Die Verse, in denen der Begriff „unterordnen“ vorkommt, befinden sich bei vielen Christen wohl eher am unteren Ende der Beliebtheitsskala. Oder würdest du dir einen dieser Verse gerahmt an die Wohnzimmerwand hängen?
Andererseits: Für den, der prinzipiell die Bibel als Ganze als Gottes Wort schätzt und liebt, hat es etwas Unbefriedigendes, wenn einzelne Bibelstellen nicht so recht unser Freund werden. Schließlich wollen wir uns die Bibel nicht nach eigenem Gutdünken zurechtstutzen. Bleibt wirklich nur, diese Anweisungen als Teil des Gesamtpakets in Kauf zu nehmen, sie – soweit sie sich nicht mit gutem Gewissen umgehen lassen – zwar nicht mit Begeisterung, aber jedenfalls halbwegs umzusetzen?
Tatsächlich sagt die Bibel noch einiges mehr zum Stichwort „unterordnen“ als im ersten Moment ersichtlich ist, und das „große Bild“ kann helfen, die Bedeutung und sogar Schönheit der Einzelteile zu erahnen.
Mehr: www.evangelium21.net.
Charles Taylor wird 90
Der kanadische Philosoph Charles Taylor wird heute 90 Jahre alt. Christian Geyer würdigt ihn mit dem Artikel „Zauber der Vernunft“ (FAZ, 05.11.2021, Nr. 258, S. 13). Zwei Zitate:
Warum Taylor zu den großen Säkularisierungs-Theoretikern gehört, hat damit zu tun, dass er die Frage nach Gott modernekritisch einfach umdrehte. Nicht nach Art von Substraktionstheorien wollte er die Moderne denken, also nicht so, dass der Mensch sich erst seiner Transzendenzen entledigt hätte, bevor er das Licht der Vernunft erblickt. Sondern umgekehrt erklärte Taylor die Transzendenzlosigkeit zu einer Schwundstufe der Vernunft, zur Minus-Vernunft.
…
Die Verleugnung der Transzendenz oder besser: den Verlust ihrer Selbstverständlichkeit macht Taylor verantwortlich für die liberalistischen Fehlentwicklungen der Moderne. Von diesem Verlust her erkennt er ein Versiegen von moralischen Quellen, ohne welche das Selbst- und Weltverständnis des Menschen defizitär bleibe, wie er in seinem Hauptwerk „Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität“ darzulegen suchte. Es ist dieser religionsphilosophische Kern, um den herum Taylor seine Anthropologie baute, über Jahrzehnte in etlichen Büchern und Aufsätzen entfaltete, dabei durchgängig den psychologischen Behaviorismus als Fehlanzeige brandmarkend. „Wie wollen wir leben?“ – diese bewusst voluntaristisch formulierten, vom aufgeklärten Individuum her gestellte Frage nimmt die Sinnfrage in die eigene Regie.
Ist der Staat Gott?
Europäische Regierungen und Parteien beziehen sich kaum noch auf Gott. Das ist nicht tragisch, wenn Säkularisierung zugleich bedeutet, dass die Religionsfreiheit verteidigt und der Staat nicht selbst zu einem neuen Gott wird, meint Giuseppe Gracia in seinem NZZ-Beitrag „Gott ist tot – der Staat ist Gott? Das wäre eine ganz schlechte Idee“.
Wer eine freie Gesellschaft bewahren will, muss die Religionsfreiheit und das freie Wirken der Religionsgemeinschaften verteidigen. Im Übrigen ist Gelassenheit geboten, wenn politische Parteien verschwinden, die ein «C» im Namen tragen. Das Christentum ist kein politisches Programm und darf nicht auf eine Partei verengt werden. Auch sind Christen keine politische Gemeinschaft, sondern eine Glaubensgemeinschaft.
So wie alle Bürger können Christen in vielen Fragen des politischen Tagesgeschäfts unterschiedliche Ansichten vertreten und verschiedene Parteien wählen. Denn es ist eine Sache, gleiche Grundsätze wie etwa die Nächstenliebe oder die Sorge um die Natur zu haben. Und etwas ganz anderes, die konkrete Umsetzung in oftmals komplexen gesellschaftlichen Realitäten zu beurteilen, bei der es einen legitimen Pluralismus der Überzeugungen gibt.
Aus dem gleichen Grund sollten die Kirchen nicht mit Jesus Politik machen. In den letzten Jahren fallen sie nämlich nicht dadurch auf, dass sie Gott oder die Auferstehung von den Toten bezeugen. Sondern dadurch, dass sie sich dem Staat andienen, als steuerfinanzierter, zivilreligiöser Moralinspender. Oder dass sie versuchen, medial angesagte Programme bezüglich Gender, Klima und Migration christlich zu imprägnieren. Das ist ein Missbrauch der Institution Kirche.
Mehr hier: www.nzz.ch.
Ulrich Wilckens (1928–2021)
Der Bischof em. Prof. Dr. Ulrich Wilckens ist am 25. Oktober 2021 heimgegangen. Wilckens bekehrte sich zu Jesus Christus, nachdem er im Schützengraben von einem Panzer überrollt wurde und überlebt hat. Er studierte Theologie und lehrte später in Marburg, Berlin und Hamburg. Von 1981 bis 1991 war er Bischof der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, die 2012 der Nordkirche zugeschlagen wurde.
Gegen Ende seiner Amtszeit erkrankte Wilckens schwer an Krebs. Dass er überraschend geheilt wurde, schrieb er Gottes Eingreifen zu und nutzte die verbleibenden Jahre für tief schürfende theologische Untersuchungen, die nicht dem Mainstream entsprachen. Er kritisierte die historisch-kritische Methode und verfasste eine sechsbändigen Theologie des Neuen Testaments (siehe meinen Buchhinweis hier: Wilckens.pdf).
Wilckens änderte auch seine Sichtweise auf die Sexualethik. Er überarbeitete seine Kommentar zum Römerbrief und schrieb auf evangelisch.de: Ein Christ müsse „sein sexuelles Verhalten ganz nach dem Willen Gottes ausrichten und daher wissen, dass gleichgeschlechtliches Zusammenleben – wie alle außereheliche Sexualität – dem Gotteswillen widerspricht“.
Im Gedenken an seinen kirchlichen Dienst hier ein längeres Zitat aus seinem Buch Kritik der Bibelkritik:
Es ist zu entscheiden, ob die historisch-kritische Auslegung der Bibel dem Anspruch gerecht wird, den ursprünglichen Sinn der biblischen Schriften zu erfassen, und zu prüfen, ob ihre Zeugnisse von der Wirklichkeit Gottes als wahr anzuerkennen sind – nämlich der Wirklichkeit seines Handelns in der Geschichte Israels und im Wirken und Geschick Jesu als Heilgeschehens für alle Menschen aller Zeiten. Eine solche Prüfung erfordert, beides ernst zu nehmen: die Aussagen der Zeugen in den biblischen Texten und die kritische Absicht der Ausleger.
Was die Prüfung der Letzteren betrifft, so gilt es nicht nur, die behaupteten »Ergebnisse« der modernen Bibelwissenschaft nachzuprüfen, sondern vor allem auch die darin angewandten Methoden auf ihre Voraussetzungen hin zu hinterfragen. Ihrem historisch-kritischen Anspruch entspricht es, dass auch ihre Überprüfung historisch-kritisch verfährt. Und das heißt: Die Geschichte der modernen Bibelforschung ist selbst historisch-kritisch zu verfolgen.
Habermas: Abschied von der Metaphysik
Hin und wieder treffe ich auf Leute, die bei Habermas eine gewisse Hinwendung zum Religiösen vermuten. Das kann damit zusammenhängen, dass er sich im Jahr 2004 mit Joseph Ratzinger getroffen hat. Seine Dankesrede zum Thema „Glauben und Wissen“ anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels mag auch eine Rolle gespielt haben. Und freilich haben einige Denker und Autoren aus seiner Philosophiegeschichte herausgelesen, die Philosophie sei irgendwie doch auf die Religion angewiesen.
Auf einer ihm gewidmeten Tagung in Tutzing hat der 92 Jahre alte Jürgen Habermas nun mit diesem Gerücht Schluss gemacht. Der Abschied von der Metaphysik entlocke ihm keine Träne. Die FAZ berichtet:
Angesichts etlicher Vorträge, die nach der sozialen Bindekraft religiöser Riten in säkularen Gegenwartsgesellschaften fragten (Thomas Schmidt) oder seiner Luther-Interpretation auf den philologischen Zahn fühlten (Micha Brumlik), legte Habermas Wert auf die Klarstellung, dass er ein „religiös unmusikalischer“ Denker geblieben sei. Er habe den Eindruck, das Buch aus anderen Motiven geschrieben zu haben, als bisher in dessen Diskussion hervorgetreten sei. Habermas charakterisierte seine Anliegen als „immanent philosophische“. Davon abgesehen, dass er ein Bild der Philosophiegeschichte berichtigen wollte, in dem das scheinbar „dunkle Mittelalter“ und die es beschäftigenden Probleme im Verhältnis von Glauben und Wissen noch nicht den gebührenden Platz einnehmen, habe er mit seiner drei Jahrtausende umfassenden Philosophiegeschichte „Tendenzen der Verengung und Spezialisierung des Faches performativ kritisieren“ wollen, dessen Abstraktionsniveau oft keinen Bezug mehr zu „maßgebenden Fragen“ erkennen lasse.
Ausdrücklich distanzierte sich Habermas damit auch von seinem eigenen, auf dem Hegel-Kongress 1981 vorgetragenem Verständnis der Philosophie als „Platzhalter“, wonach sie als Produzent substanzieller Fragestellungen unersetzlich sei, die Antworten aber den Wissenschaften überlassen müsse. Demgegenüber wollte er im aktuellen Werk einen anspruchsvollen Begriff der Philosophie erneuern, der sie nicht nur auf Begriffsanalyse oder wissenschaftliche Zubringertätigkeiten beschränkt, sondern in ihr Beiträge zu einer „rationalen Welt- und Selbstverständigung“ sieht.
Mehr hier: www.faz.net.