Am 10. März 1929 hielt Professor J. Gresham Machen seine letzte Predigt vor den Studenten des Princeton Theological Seminary (USA). Machen hatte lange gegen die Umstrukturierung des Seminars gekämpft. Letztlich hat er aber diese Schlacht verloren. Die Modernisten konnten die Kontrolle über die Ausbildungsstätte übernehmen und die theologischen Konservativen wurden verdrängt.
In den folgenden Monaten wurden hastig die Pläne für die Gründung des Westminster Theological Seminary geschmiedet, und die neue Schule wurde im Herbst 1929 unter Machens Leitung eröffnet. All das macht seine letzte Princeton-Predigt zu einer wichtige Zeugin dieser kontroversen Zeit.
Machen betonte unter anderem einen Punkt, der auch für unsere Tage von größter Bedeutung ist: Es ist keine große Sache, den christlichen Glauben als einen Weg vorzustellen, auf dem Menschen mit Gott versöhnt werden. Widerstand gibt es dann, wenn wir das Ärgernis des Kreuzes verkündigen, das heißt, wenn wir aussprechen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, auf dem Menschen zu Gott zurückkehren können. Aber genau diese Kreuzesbotschaft ist wahr und ihre Verkündigung ist die Berufung der Kirche.
Die Warnung J. Gresham Machens:
Gott bewahre uns also vor dieser „Toleranz“, von der wir so viel hören: Gott erlöse uns von der Sünde, mit denen gemeinsame Sache zu machen, die das gesegnete Evangelium Jesu Christi leugnen oder ignorieren!
gilt uns heute so wie den Christen vor knapp 100 Jahren. Hier seine Predigtausführungen im Zusammenhang:
Wenn Sie sich dafür entscheiden, für Christus zu einzustehen, werden Sie kein leichtes Leben haben. Natürlich können Sie versuchen, sich dem Konflikt zu entziehen. Alle Menschen werden gut von Ihnen sprechen, wenn Sie, nachdem Sie am Sonntag ein noch so unpopuläres Evangelium gepredigt haben, am nächsten Tag in den Kirchenräten nur gegen dieses Evangelium stimmen; man wird Ihnen gnädigerweise erlauben, an das übernatürliche Christentum zu glauben, so viel Sie wollen, wenn Sie nur so tun, als würden Sie nicht daran glauben, wenn Sie nur mit seinen Gegnern gemeinsame Sache machen. Das ist das Programm, das die Gunst der Kirche gewinnen wird. Ein Mensch mag glauben, was er will, solange er nicht stark genug glaubt, um sein Leben dafür zu riskieren und dafür zu kämpfen.
„Toleranz“ ist das große Wort. Die Menschen bitten sogar um Toleranz, wenn sie im Gebet zu Gott schauen. Aber wie kann ein Christ ein solches Gebet überhaupt beten? Was für ein schreckliches Gebet ist das, wie voll von Untreue gegenüber dem Herrn Jesus Christus! Es gibt natürlich einen Sinn, in dem Toleranz eine Tugend ist. Wenn man darunter die Toleranz von Seiten des Staates versteht, die Nachsicht der Mehrheit gegenüber der Minderheit, die entschiedene Ablehnung jeglicher Maßnahmen des physischen Zwangs, um das Wahre oder das Falsche zu verbreiten, dann sollte der Christ natürlich die Toleranz mit aller Kraft befürworten und das weitverbreitete Wachstum der Intoleranz im heutigen Amerika beklagen. Oder wenn Sie mit Toleranz Nachsicht gegenüber persönlichen Angriffen auf Sie selbst meinen, oder Höflichkeit und Geduld und Fairness im Umgang mit allen Irrtümern, welcher Art auch immer, dann ist Toleranz wiederum eine Tugend.
Aber um Toleranz zu beten, abgesehen von den eben genannten Formen, insbesondere um Toleranz zu beten ohne sorgfältig definieren, in welchem Sinne man tolerant sein soll, heißt nur, den Zusammenbruch der christlichen Religion herbeizubeten; denn die christliche Religion ist [im Blick auf die Lehre] durch und durch intolerant. Darin liegt das ganze Ärgernis des Kreuzes – und auch die ganze Kraft des Kreuzes. Immer wäre das Evangelium von der Welt mit Wohlwollen aufgenommen worden, wenn es nur als ein Weg der Erlösung dargestellt worden wäre; der Anstoß kam, weil es als der einzige Weg dargestellt wurde und weil es allen anderen Wegen unerbittlich den Kampf angesagt hat. Gott bewahre uns also vor dieser „Toleranz“, von der wir so viel hören: Gott erlöse uns von der Sünde, mit denen gemeinsame Sache zu machen, die das gesegnete Evangelium Jesu Christi leugnen oder ignorieren! Gott bewahre uns vor der tödlichen Schuld, die Anwesenheit derer als unsere Vertreter in der Kirche zuzulassen, die Jesu Kinder in die Irre führen; Gott mache uns, was immer wir sonst sind, zu rechten und treuen Boten, die ohne Furcht und Gunst nicht unser Wort, sondern das Wort Gottes verkündigen.
 In diesem Interview habe ich mit Alexander Reindl, dem Geschäftsführer von Evangeliums21, über die anstehende E21-Hauptkonferenz gesprochen, die vom 22.–24. April als Hybrid-Konferenz geplant wird. Wir freuen uns auf die Konferenz mit Dr. Stephen Nichols (Ligonier Ministries) sowie Dr. Michael Reeves (Union School of Theology).
In diesem Interview habe ich mit Alexander Reindl, dem Geschäftsführer von Evangeliums21, über die anstehende E21-Hauptkonferenz gesprochen, die vom 22.–24. April als Hybrid-Konferenz geplant wird. Wir freuen uns auf die Konferenz mit Dr. Stephen Nichols (Ligonier Ministries) sowie Dr. Michael Reeves (Union School of Theology). 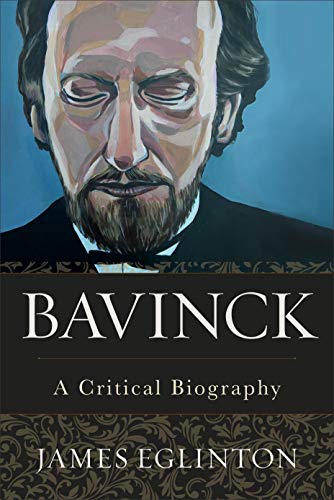 Wenn zwei ausgewiesene Bavinck-Experten wie Brian Mattson und James Eglinton sich unterhalten, lohnt es sich, mal „reinzuhören“. Evangelium21 hat ihr Gespräch in die deutsche Sprache übersetzt.
Wenn zwei ausgewiesene Bavinck-Experten wie Brian Mattson und James Eglinton sich unterhalten, lohnt es sich, mal „reinzuhören“. Evangelium21 hat ihr Gespräch in die deutsche Sprache übersetzt.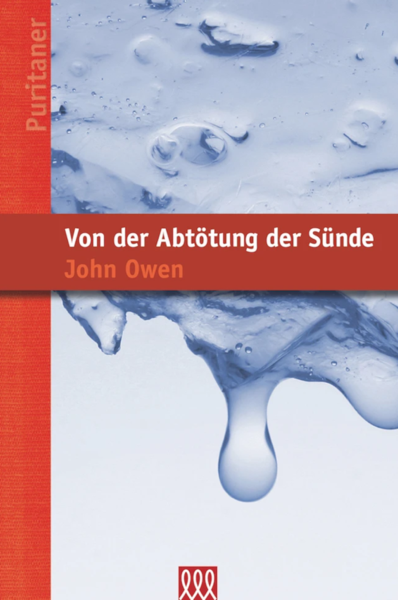 Sebastian Götz stellt ein bedeutendes Werk zur Sündenlehre vor, nämlich John Owens Buch Von der Abtötung der Sünde. Er schreibt:
Sebastian Götz stellt ein bedeutendes Werk zur Sündenlehre vor, nämlich John Owens Buch Von der Abtötung der Sünde. Er schreibt: