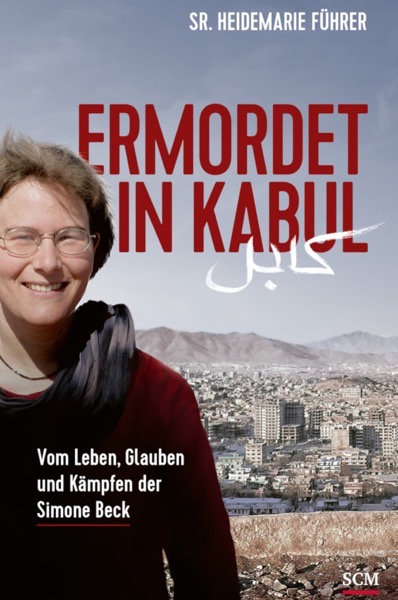Helmut Henschel hat für Evangelium21 das hier schon im Dezember empfohlene Buch Visual Bible Guide rezensiert. Er schreibt:
Die größte Stärke des Buches zeigt sich im dritten und letzten Teil des Visual Bible Guide. Dort wird der rote Faden des Heilsplanes Gottes im Sinne der Biblischen Theologie ausgebreitet. Jesus selbst ist Mitte und Auslegungsprinzip der Schrift. Von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende zeigt die Bibel, dass es in ihr nicht so sehr um uns, sondern um Gott – d.h. Jesus – geht. An diesem Punkt sind die Visualisierungen besonders hilfreich, ist es so doch möglich, sehr schnell einen Überblick über die Entfaltung von Gottes Plan durch die ganze Schrift zu erhalten. Dabei wird aufgezeigt, wie die einzelnen Bücher und Gattungsgruppen der Bibel auf ihre eigene Art auf Jesus hinweisen und seine Zentralität deutlich machen. Das bringt am Ende sehr effektive Auslegungshilfen, die beim eigenen Studium enorm hilfreich sein können. Durch die Grafiken einprägsam ausgeführt, erfährt man z.B., dass man die literarischen Bücher des Alten Testaments als Ausdruck der Sehnsucht nach Jesus verstehen sollte. Das dürfte gerade jungen Christen eine große Ermutigung sein, die Texte nicht nur zu lesen, sondern auch diesbezüglich zu interpretieren.
Zwei Eigenschaften heben diese Publikation besonders hervor: Naturgemäß die Visualisierungen und Informationsgrafiken, die ihre besondere Stärke im letzten Teil entwickeln, und der konsequent biblisch-theologische Ansatz, der sich durch das ganze Buch zieht und dann vor allem im dritten Teil ausführlich zur Sprache kommt. Das alleine ist eine Anschaffung und Lektüre auf jeden Fall wert.
Mehr: www.evangelium21.net.