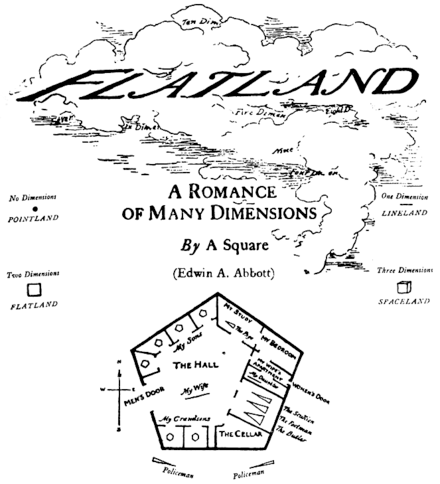Die scheinbare Überlegenheit des modernen Menschen
Die Physikerin und Philosophin Sibylle Anderl nimmt die Leser der ZEIT mit hinein in ihre Suche nach dem richtigen Glauben. Ihre Fragen sind klug und hilfreich. Leider setzt sie aber wie Rudolf Bultmann selbstverständlich voraus, dass wir heute klüger sind als die Menschen in der Antike und unser Wissensstand und „Weltbild“ darüber entscheidet, was wir uns aus der Bibel herauspicken. Ich wäre ja zurückhaltender: In mancherlei Hinsicht sind wir heute reicher und klüger, und in mancherlei Hinsicht ärmer und dümmer. Vielleicht ist ja das Weltbild, das Wunder oder ein Letztes Gericht kategorisch ausschließt, das eigentlich mythologische. Spätestens am Tag des Herrn wird das offenbar werden: „Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich“ (Phil 2,10).
Hier das Zitat (DIE ZEIT, 05.06.2025, Nr. 24, S. 30):
Unser menschliches Wissen verändert sich mit der Zeit. Einst Rätselhaftes wird verstanden. Manches Verstandene wird wieder vergessen. Fest steht, dass sich unser heutiges Wissen grundlegend von dem der Menschen unterscheidet, die zur Entstehungszeit der Bibel lebten.
Der evangelische Theologe Rudolf Bultmann sah darin vor achtzig Jahren den Grund, warum sogar viele Christen sich damit schwertun, das Neue Testament wörtlich zu nehmen: Die objektive Welt, wie wir sie erleben, existierte für die Menschen damals nicht. Sie besaßen keinen wissenschaftlichen Zugang zur Realität, es gab für sie keine Atome, keine chemischen Reaktionen und keine fernen Galaxien. Sie lebten in einer mythischen Wirklichkeit, in der ganz selbstverständlich übernatürliche Mächte wirkten, Gott, die Engel, Satan und dessen Dämonen. Tote konnten auferstehen, und das Jüngste Gericht wurde jederzeit erwartet. Dieses Weltbild sei das einer vergangenen Zeit, schreibt Bultmann, zu unserem wissenschaftlichen Denken passe es nicht mehr.
Laut Bultmann ist es eine Zumutung, als Christ das vergangene mythische Weltbild als wahr anerkennen zu müssen, obwohl es im krassen Widerspruch zu unserem modernen Wissen steht.
Ich stimme Bultmann zu: Es ist eine Zumutung. Und ich finde die Lösung sinnvoll, die er vorschlägt. Die biblischen Texte so zu interpretieren, dass sie auch in unserer Zeit funktionieren. Sich zu fragen, welche Inhalte wir wörtlich nehmen müssen und was auf die mythische Denkweise von damals zurückzuführen sein mag. Wahrscheinlich bin ich dabei teils sogar toleranter als Bultmann, weil ich weiß, dass die Grenzen unseres naturwissenschaftlichen Wissens weniger starr sind, als wir gemeinhin glauben.